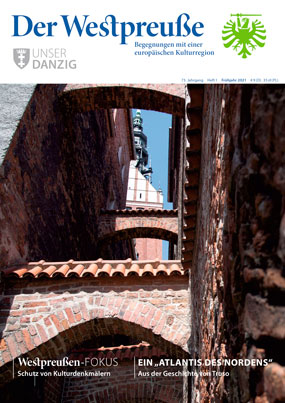Eine aktuelle Studie erschließt das Spannungsverhältnis zwischen der Flucht und Vertreibung der Deutschen und der europäischen Erinnerungskultur
Von Manfred Kittel
Flucht und Vertreibung der Deutschen aus ihren alten Staats- und Siedlungsgebieten im Osten um 1945 sind in den davon am stärksten geprägten Ländern Polen, Tschechien und Deutschland nach der großen europäischen Revolution von 1989/90 immer wieder zum gesellschaftlichen Konfliktthema geworden. Kristallisationspunkte dieser Debatten waren als „Leitmedien der Erinnerungskultur“ regionale und nationale Museumsprojekte zur deutschböhmischen und schlesischen Geschichte im tschechischen Aussig (Ústí nad Labem) bzw. in München, im polnischen Kattowitz (Katowice) bzw. in Görlitz und vor allem auch die zumindest in ihrer Entstehung antipodisch zu verstehenden Pläne für ein Berliner Dokumentationszentrum zu „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ – mit ihrer polnischen Reaktion in Gestalt eines Museums des Zweiten Weltkrieges in Danzig.
Als Indikator für die hohe Temperatur der Konflikte kann der personelle Verschleiß gelten, der in diesen Erinnerungskulturbetrieben habituell erfolgt. Bis zur Eröffnung brauchte es – rechnet man Interimslösungen und zwar berufene, aber dann noch vor Amtsantritt doch wieder erfolgreich vergraulte Persönlichkeiten mit ein – mindestens zwei, in der Spitze (nicht nur in Berlin) gleich bis zu vier Gründungsbeauftragte bzw. ‑direktoren. Die einzige Ausnahme von dieser Regel bildete mit dem Görlitzer Museum nicht ganz zufällig jenes Projekt, das am frühesten, in den noch stark von der ersten Versöhnungseuphorie nach 1989/90 geprägten Jahren, auf den Weg gebracht worden war (Eröffnung bereits 2006) und wo zudem von Anfang an klare Machtverhältnisse in den Gremien herrschten. Ein Sonderweg wurde dagegen bei einem siebten Museum beschritten, das Vincent Regente in seiner unlängst erschienenen Monographie Flucht und Vertreibung in europäischen Museen eher in etwas kursorischer Form noch mit in den Blick nimmt: dem Haus der Europäischen Geschichte in Brüssel, in dessen riesigem Themenspektrum die Historie der Vertreibung naturgemäß nur einen kleinen, aber gleichwohl wichtigen Raum einnimmt. Hier lag die Hauptverantwortung lange bei dem in Brüssel quasi nur nebenamtlich agierenden und insofern nur bedingt angreifbaren Präsidenten des altbewährten Bonner Hauses der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dem für alle Fälle ein polnischer Professor als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats attachiert war.
Das Beharrungsvermögen tradierter Stereotypen
Die Studie Regentes wird von der Frage geleitet, weshalb die Darstellung der Ostvertriebenen als Opfer des Zweiten Weltkrieges in der Erinnerungskultur des vereinten Europas auch nach Jahren der Verständigungspolitik nach wie vor so umstritten ist und welche diskursiven Entwicklungen hierbei zu Veränderungen führten. Antworten auf diese Fragen sucht Regente sowohl in den innergesellschaftlichen als auch in den zwischenstaatlichen und EU-weiten Diskursen der Untersuchungsländer Polen, Tschechien und Deutschland. Der aus arbeitsökonomischen Gründen auf die drei vom Thema hauptbetroffenen Staaten gerichtete Fokus ist nachvollziehbar, wenngleich das Weglassen Österreichs nicht nur wegen der Rolle Wiens beim Streit um die Beneš-Dekrete in den frühen 2000er Jahren etwas bedauerlich ist und Seitenblicke vor allem nach Ungarn oder in die Slowakei natürlich ebenfalls noch von Interesse gewesen wären. Auch der Aufbau der Arbeit hat (nach einigen dissertationstypischen Felgaufschwüngen theoretisch-methodischer Art) seine Plausibilität: Zunächst werden Flucht und Vertreibung als historisches Ereignis differenziert rekapituliert, bevor die Diskurse dazu in der Zeit des Ost-West-Gegensatzes bis 1989/90 und danach in den Blick genommen werden. Erst auf diesem breiten, das halbe Buch beanspruchenden Fundament folgt dann eine Untersuchung von Geschichte, Konzeption und Rezeption der sieben, teilweise bis heute noch nicht eröffneten Museen.
Dabei macht sich bezahlt, dass der Verfasser für die Arbeit eigens nicht nur Polnisch, sondern auch Tschechisch gelernt und den Anspruch hat, das Thema nicht nur aus einer rein binnendeutschen Perspektive zu betrachten: Unsere östlichen Nachbarländer, so moniert er zu Recht, würden in der Bundesrepublik oft als „unterkomplexe Einheiten“ (S. 524) behandelt, auf deren – aber gar nicht näher verstandene – Empfindlichkeiten pauschal Rücksicht zu nehmen sei. Auf seiner trinationalen Quellengrundlage kommt Regente zu dem Ergebnis, dass geschichtspolitische Dissense oft auf einer selektiven Thematisierung einzelner Phasen umstrittener historischer Ereignisse und ihrer unterschiedlichen Kontextualisierung beruhten. Die Auseinandersetzungen um Flucht und Vertreibung hätten sich zwar mehrfach in einem gemeinsamen Diskursraum vereint, wären aber nur selten in Dialog oder Trialog gemündet. Selbst zwischen Tschechien und Polen habe es nur bedingt gemeinsame Positionen (etwa auch zum Berliner Museumsprojekt) gegeben – Prag hielt sich sichtlich zurück –, und die selbstkritischen Debatten zum Vertreibungsthema in den östlichen Nachbarländern während der 1990er Jahre seien in der Bundesrepublik kaum registriert worden. Letztlich wären in allen Ländern nationale Perspektiven und ältere Meistererzählungen in Kraft geblieben.
Deutsche Missinterpretationen und polnische Verkürzungen
Regentes Studie dürfte für deutschsprachige Interessenten schon deshalb aufschlussreich sein, weil sie viele Einzelfragen durch intensive Spiegelung in polnischen und tschechischen Diskursen um hierzulande oft weniger bekannte Aspekte vertieft – nicht nur dort, wo es sich um die Museumsprojekte selbst handelt, sondern auch bei deren umfangreicher Voraussetzungsgeschichte seit 1945. Hier geht es etwa auch um das in Deutschland seit der EKD-Ostdenkschrift 1965 epidemisch gewordene Fehlurteil, die Westverschiebung Polens sei doch vor allem eine Entschädigung für den Verlust der Ostgebiete der polnischen Zwischenkriegsrepublik, der sogenannten „kresy“, gewesen, was im Blick auf die gut viermal größere Zahl der Deutschen in den preußischen Ostgebieten ziemlich abwegig ist. Regente verweist zudem darauf, dass die schräge Kompensationstheorie zu kommunistischer Zeit in Warschau offiziell gar nicht verwendet wurde, um das Bündnis mit der Sowjetunion, dem eigentlichen Hauptprofiteur der Grenzverschiebungen, nicht zu diskreditieren.
Die zähe kommunistische und leider zugleich nationalkatholische These von den urpolnischen Oder / Neiße-Gebieten sieht Regente ebenfalls kritisch: Die mittelalterliche dynastische Herrschaft der Piasten in Schlesien etwa über damals dünn besiedelte Gebiete dürfe nicht mit den Verhältnissen eines modernen Territorialstaates später verwechselt werden. Das Narrativ blende obendrein aus, dass die schlesischen Herzogtümer auf friedlichem Wege in den deutschen Kulturkreis übergegangen seien. Der nach 1945 mit außergewöhnlicher Ausdauer über viele Jahrzehnte propagierte Mythos von den wiedergewonnenen Gebieten im Westen habe aber dennoch „offenkundig die Bevölkerung erreicht“ (S. 179) und zu einer teilweise bis heute anhaltenden Akzeptanz dieses Deutungsmusters beigetragen. 1981 diente es dem Jaruzelski-Regime im Kampf gegen die angeblich vom Westen korrumpierte Solidarność-Bewegung, indem man sich einredete, „revanchistische“ Kräfte in der Bundesrepublik wollten den drohenden Staatsbankrott Polens zum Rückkauf der Oder / Neiße-Gebiete nutzen. Volkspolnische Solidarność-Gegner brachten in diesem Kontext sogar – allerdings vergeblich – Bilder von Adenauer im Mantel des Deutschen Ordens, US-Präsident Reagan als Cowboy und einem weiteren historischen Ritter in Umlauf, um vor einem „dritte[n] Kreuzzug nach Polen“ zu warnen (S. 175).
Der tschechische Vertreibungsdiskurs
Der Vergleich dieser polnischen Vertreibungsdiskurse mit den tschechischen bzw. tschechoslowakischen ist besonders aufschlussreich. Zwar stieß der „Abschub“ der Deutschen auch in der Bevölkerung der ČSSR auf breite Zustimmung, doch lagen die Verhältnisse nicht nur wegen der vergleichsweise schwachen Rolle der katholischen Kirche und der ungleich größeren Akzeptanz der Kommunistischen Partei – gerade in den „ethnisch gesäuberten“ Sudetengebieten – ganz anders. Hinzu kam noch, dass die Prager Beziehungen zu Russland auch wegen der sowjetischen Politik in der Zeit des Münchner Abkommens 1938 oder wegen des „Fehlens“ eines tschechischen Katyn traditionell deutlich besser waren. Überhaupt war das Thema Vertreibung in den böhmischen Ländern, wo letztlich in einer speziellen Art von Bürgerkrieg zwei Drittel der Bevölkerung eines Landes das andere, sehr eng verwandte Drittel kollektiv vertrieben hatten, für das nationale Selbstverständnis ungleich wichtiger als in Polen, dem 1945 zum größten Teil fremde Staats- und Siedlungsgebiete – faktisch doch als Entschädigung für die unbeschreiblichen Verwüstungen des Landes durch die NS-Besatzung – einverleibt worden waren.
Eine relativ starke, kaum gewendete orthodoxe kommunistische Partei gehörte vor diesem Hintergrund nach 1989/90 zu den Spezialitäten des Vertreibungsdiskurses in Tschechien. Die Wirkungen dieses Sachverhalts auf den äußerst mühsamen deutsch-tschechischen Dialog hätten in Regentes Studie vielleicht noch klarer herausgearbeitet werden können. Sicher ist es schade, dass Václav Havels große frühe Versöhnungsgesten bei führenden Sudetendeutschen nicht auf fruchtbareren Boden fielen. Für ein Gesamturteil sollte man aber auch dazu sagen, dass etwa der tschechoslowakische Ministerpräsident Marian Čalfa, mit dem sich der Sprecher der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) Anfang der 1990er vergeblich „durch dreihundert Jahre deutsch-tschechische Geschichte kämpfte“ (S. 246), ein langjähriger KP-Funktionär war, der seine Partei erst kurz zuvor verlassen hatte. Unklar bleibt an dieser Stelle auch, weshalb es „wenig hilfreich“ (S. 256) gewesen sein soll, dass die SL nicht bereit war, ihre bisherige Kernargumentation „gegenüber der ersten tschechoslowakischen Republik“ aufzugeben. Denn hätte es die letztlich auf Assimilierung abzielende, im Kern falsche Nationalitätenpolitik Prags in den Sudetengebieten nicht gegeben, könnte man sich die ganze Henlein-Bewegung mitsamt der Anschluss-Begeisterung von 1938 doch allenfalls mit einer puren Lust an der NS-Ideologie selbst erklären; und die spätere Vertreibung der Deutschen würde dann – aber nur dann – tatsächlich wie eine gerechte Strafe aussehen.
Museumsprojekte auf schwankendem Boden
Die auch nach 1990 kompliziert bleibenden Vertreibungsdiskurse in den Gesellschaften Mitteleuropas spitzten sich in den 2000er Jahren noch zu, als Tschechien nicht einmal auf dem Weg zum EU-Beitritt den krass menschenrechtswidrigen Teil der Beneš-Dekrete aufheben wollte, der die Vertreibung der Deutschen mit einem scheinlegalen Mäntelchen umhüllt hatte. In Polen wurden parallel dazu die Aktivitäten einer neuen, in teils sehr zweifelhaftem Duktus auf das Eigentumsrecht pochenden „Preußischen Treuhand“ in der Bundesrepublik, so winzig diese war, groß instrumentalisiert, um das ganz andere, vom Bund der Vertriebenen verfolgte Anliegen eines „Zentrums gegen Vertreibungen“ in Berlin zu verhindern. So war die politische Großwetterlage, in der die Museumsprojekte dieser Jahre auf den Weg gebracht wurden, das Danziger 2008, das Berliner ein Jahr später kraft eines überdehnten Kompromisses der schwarz-roten Koalition zur Gründung einer „Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung“, erheblich angespannt.
Regente arbeitet heraus, wie die in diesem Reizklima erfolgenden Direktorenwechsel oft auch mit neuen inhaltlichen Weichenstellungen verbunden waren. Erstaunlich, dass sich dies trotz der Spannungen im deutsch-tschechischen Vertreibungsdiskurs bei den Projekten in Aussig und München zumindest für die Öffentlichkeit am wenigsten erschloss, auch wenn im böhmischen Fall der starke altkommunistische Einfluss in der Region kaum zu übersehen ist. In Danzig dagegen wurde der verdiente Gründungsdirektor erst auf den letzten Metern, praktisch mit der Eröffnung seines Hauses 2017, im Zuge eines klaren kulturpolitischen Rollbacks durch die rechtsnationalistische Regierung in Warschau aus dem Verkehr gezogen. Im Schlesien-Museum in Kattowitz hatte es gleich anfangs eine Diskussion über den Anteil der deutschen Geschichte im Haus gegeben. Die Ausstellungsmacher planten, diesen auch seiner wirklichen Bedeutung entsprechend breit darzustellen und mit dem Kapitel der Industrialisierung zu beginnen. Der polnischen Rechten aber war das denn doch „zu deutsch“; und nach dem erzwungenen Rücktritt des Gründungsdirektors 2013 wurde die Konzeption geändert und stattdessen mit dem piastischen Schlesien begonnen.
Züge einer Realsatire trug es, dass, wie Regente schildert, nicht nur der Direktor eines polnischen Regionalmuseums wegen angeblich zu großer Deutschfreundlichkeit aus dem Amt gedrängt wurde, sondern dass dieser „Vorwurf“ 2014 auch in Deutschland selbst (!) gegen den damaligen Direktor der Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, den Autor dieses Beitrags, erhoben wurde. Nach seinem Amtsverzicht, so jubelte nicht nur eine Berliner Lokalzeitung, sei endlich die „Fixierung aufs Deutsche“ überwunden worden, wo sich die Vertriebenenverbände doch ohnehin „schlicht überlebt“ hätten (S. 404). Ein neues Konzept nahm laut Regente gegenüber den früheren Ausstellungsplänen „verstärkt die kurze Linie“, also eine Verortung der Vertreibungsursachen „im Kontext des Zweiten Weltkrieges“ vor (S. 402), während die längeren Linien – etwa Pläne politisch relevanter Gruppen in Polen und der ČSR auch schon vor 1933/39, die Zahl der Deutschen zu reduzieren – in den Hintergrund getreten seien. Dies habe aber sowohl „den von linksliberaler Seite“ (S. 409) in der Bundesrepublik stets erhobenen Forderungen wie auch national-polnischen und ‑tschechischen Positionen entsprochen.
Die Hintergründe der seinerzeitigen Personalintrigen hätte man mit analytischem Gewinn auch noch etwas näher beleuchten können; denn etwa im Politikteil der FAZ oder noch ausführlicher in der von Regente anderweitig gut berücksichtigten Sudetendeutschen Zeitung war ja bereits damals öffentlich klargestellt worden, dass die auf eine Wechselausstellung der Berliner Stiftung bezogenen Vorwürfe, die vertriebenen Deutschen als die „einzigen Opfer des Krieges“ gezeichnet zu haben (Gazeta Wyborcza), objektiv der Wahrheit widersprachen. Nur wurden sie auch im linken Medienmahlstrom der Bundesrepublik solange hin und her gespült, bis auf politischer Seite die üblichen Reflexe erfolgten.
Ideologische Asymmetrien
Der (erinnerungs-)kulturellen Hegemonie der Linken in der Bundesrepublik seit 1968, auf die Regente in diesen Passagen implizit Bezug nimmt, scheint auch eine spezielle literarische Usance seiner Dissertation Rechnung zu tragen: nämlich Äußerungen von Historikern v. a. der Zeit- und der Osteuropäischen Geschichte, die politisch heute – ähnlich der Journalistenklasse – zu etwa 80 % rot-rot-grün zu verorten sind, nicht näher zu klassifizieren, bei „konservativen“ oder gar als „nationalkonservativ“ geltenden Geschichtswissenschaftlern diese Eigenschaft dem Leser hingegen explizit mitzuteilen. Gewiss würde es etwas langweilig, die Klassifizierungsprozedur bei der großen, unterschiedlich ausgeprägten linken Mehrheit jedes Mal in gleicher Weise zu vollziehen. Doch zumindest in einigen extremeren Fällen, etwa bei dem mehrfach zitierten, in den 1950er Jahren tief im K‑Bereich verstrickten Kurt Nelhiebel, einem der „antifaschistischen“ Oberkritiker der Vertriebenenverbände, wäre diese Information im Sinne einer „Gleichberechtigung“ sicherlich hilfreich gewesen.
Und zwar umso mehr, als Regente viel zu viel über die Geschichte des Themas Vertreibung weiß, um an vielen Stellen – unbeschadet seiner Maxime, sine ira et studio schreiben zu wollen – nicht immer wieder diverse Zeitgeist-Klischees aufzuspießen. Die Vertriebenen sieht er trotz der Verstrickung auch vieler Ostdeutscher ins NS-System ausdrücklich als eine wenngleich spezielle „Opfergruppe“ (S. 20). Ihr Anspruch auf Erinnerung sei berechtigt. Und selbst bei den individuell schuldig Gewordenen sei sehr fraglich, ob deren Vertreibung als eine im rechtsstaatlichen Sinne angemessene „Bestrafung“ betrachtet werden dürfe.
Zweifel werden schließlich auch an der modischen These laut, das alte multikonfessionelle und multiethnische Ost-Mitteleuropa könne als Vorbild für die vielbeschworene multikulturelle Gesellschaft der Gegenwart taugen. Denn das vergangene „Modell“ habe auf einer – heute unvorstellbaren – festen Zuordnung gesellschaftlicher Rollen nach Konfession und Ethnie sowie struktureller sozialer Ungleichheit beruht. Besonders verdienstvoll ist aber, dass Regente auch dem skandalösen Buch des polnischen Historikers Jan Piskorski Die Verjagten Aufmerksamkeit schenkt, das wohl auch durch seine Veröffentlichung in einem lange sehr renommierten Verlag vor den eigentlich überfälligen Verrissen bewahrt wurde. Regente erinnert hier daran, dass Piskorski, der die Vertreibung als eine historische Notwendigkeit betrachtet, selbst den für Ostdeutsche geschaffenen Internierungslagern, wo ab 1945 Tausende infolge systematischer Gewalt ums Leben kamen, noch etwas Positives abgewinnt, ja sie als „eine Art Refugium“ verklärt, das seinen Insassen „in schweren Zeiten […] ein Minimum an Sicherheit und Verpflegung“ geboten habe (S. 140).
„Nehmt alles nur in allem“ hat Regente ein in vielerlei Hinsicht ausgesprochen aufschlussreiches Stück „public history“ geschrieben. Es bietet eine gute Grundlage für künftige Historiker, um in 30 Jahren, wenn die Protokolle von Stiftungsgremien und andere interne Unterlagen zugänglich sein werden, die Hintergründe einer noch zwei Generationen nach dem GAU so verstrahlten Erinnerungskultur der Vertreibung aus den Quellen darzustellen.