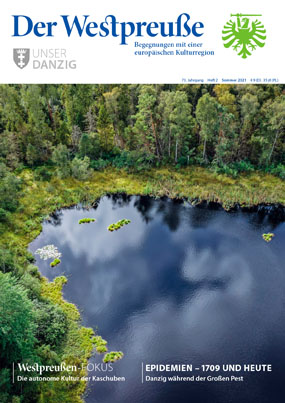Ein Speicher der Erinnerung an die Kulturgeschichte der Region
Von Magdalena Pasewicz-Rybacka
Nach nur dreißig Kilometern erreicht man von Danzig aus die malerisch an vier Seen gelegene Stadt Karthaus (Kartuzy), die als „Hauptstadt der Kaschubei“ bezeichnet wird. Diese Akzentuierung erscheint durchaus berechtigt, denn Karthaus verfügt nicht nur über eine reiche Geschichte, prächtige Baudenkmäler und bezaubernde Aussichtspunkte, sondern beherbergt auch diejenige Institution, die sich seit langem der Aufgabe widmet, das Andenken an die Traditionen der Kaschuben für die Nachwelt zu bewahren und sie zugleich für die Gegenwart lebendig zu erhalten; denn hier befindet sich – neben dem seit 1970 in Putzig aufgebauten „Florian-Ceynowa-Museum des Putziger Landes“ – das zentrale Muzeum Kaszubskie, das das Alltagsleben und die Bräuche der Kaschuben dokumentiert, erforscht und präsentiert.
Geschichte des Museums
Bereits in der Zwischenkriegszeit waren Anstrengungen unternommen worden, ein Museum zu gründen, in dem Gegenstände der kaschubischen Kultur gesammelt werden sollten. Zunächst fand sich Raum in einem Gebäude des ehemaligen Krankenhauses, wo in einem ersten Schritt 106 Exponate zusammengetragen wurden. Einige Zeit später, in den 1930er Jahren, begann sich Franciszek Treder, ein für die Geschichte seiner Heimat begeisterter junger Mann, für den Schutz des kaschubischen Erbes einzusetzen. Er bemühte sich seinerseits, historische Erinnerungsstücke sowie Zeugnisse der Volkskunst und des Volkshandwerks systematisch zu erfassen und organisierte 1932 in seinem Heimatort Borschestowo (Borzestowo) eine eigene Ausstellung. 1939 erhielt er dann auch offiziell den Auftrag, in Karthaus ein kaschubisches Museum zu errichten; doch dieser Plan wurde aufgrund des Kriegsausbruchs nicht mehr in die Tat umgesetzt.
Bereits unmittelbar nach dem Ende des Krieges, noch im Jahre 1945, wurde das Projekt wiederaufgenommen. Im „Kaschubischen Hof“, einem ehemaligen Hotel, entstand die Keimzelle dieser Einrichtung. Kurz darauf wurde sie in eine historische Villa in der Kościerska-Straße verlegt, in der sie sich bis heute befindet. Neuerlich wurde die Aufgabe vertrauensvoll in die Hände von Franciszek Treder gelegt; und am 1. Mai 1947 konnte das Museum offiziell eröffnet werden. Es blieb bis zu Treders Pensionierung im Jahre 1974 unter dessen Leitung und trägt heute den Namen seines Förderers: Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera
Jenseits der Einschränkungen, die von der Corona-Pandemie verursacht worden sind, darf das Museum heute pro Jahr etwa 20.000 Besucher begrüßen, die sich genauer über das Leben der Kaschuben informieren wollten. Die attraktive Dauerausstellung ist inzwischen in zwei Gebäuden untergebracht, denn zusätzlich zum Haupthaus, das acht Themenräume beherbergt, wurde 2019 in einem modernisierten Wirtschaftsgebäude u. a. „Basils Schmiede“ (Kuźnia Bazylego) eingerichtet, eine Werkstatt, in der zahlreiche Exponate das Arbeitsfeld des alten Schmiedehandwerks anschaulich werden lassen.
Die Abteilungen des Museums entführen den Besucher, wie der folgende Rundgang zeigen möchte, in die Welt der ehemaligen Kaschubei und laden ihn dazu ein, sich dank den mannigfachen wertvollen Belegen, die zumeist aus dem 19. und dem frühen 20. Jahrhundert stammen, differenziert mit dieser vielfältigen Kultur auseinanderzusetzen.
Ernährungssicherung und Haushaltung
Zwei der vier Räume im Erdgeschoss des Hauptgebäudes beschäftigen sich mit den Grundlagen der Existenzsicherung, der Landwirtschaft und der Fischerei. – Die geringe Qualität des Bodens ermöglichte beim Ackerbau nur einen dürftigen Ertrag, und das wenig förderliche Klima minderte die Aussichten noch zusätzlich. Aus diesem Grund gehörten die meisten Kaschuben zu den ärmeren Bevölkerungsschichten. Sie bewirtschafteten das Land mit einfachen Holzwerkzeugen und erledigten die Arbeit oft von Hand und manchmal sogar ohne die Hilfe von Nutztieren. Die Ausstellung zeigt viele alte Objekte der Arbeiten im Landbau: Pflüge, Eggen oder Joche für Gespanne. Zudem gibt es Beispiele einfachen Schuhwerks z. B. aus Buchenholz, Filz und aus geflochtenem Stroh, das auch allgemein als Füllmaterial genutzt wurde. Ein besonderes Beispiel bilden die Seitenpolster eines kunstvoll gearbeiteten Holzschlittens.
Zahlreiche fischreiche Seen sowie – im nördlichen Landesteil – der Zugang zum offenen Meer bildeten die Voraussetzungen für die Entwicklung des zweiten Berufszweiges, der Fischerei. Das Augenmerk wird zunächst auf zwei Bootstypen gelenkt, die von den Kaschuben benutzt worden sind. Der ältere Typ ist ein aus einem einzigen Stamm gefertigter Einbaum, der mit Hilfe von schwelendem Feuer ausgehöhlt worden ist. Das ausgestellte Exemplar stammt aus dem Jahre 1788. Solche Einbäume wurden dann durch Boote ersetzt, die nach üblicher Bauart aus einem Holzboden und Seitenwänden mit eingepassten Planken bestehen. Die Fische wurden, wie anschaulich gemacht wird, mit einer Vielzahl von Netzen gefangen, die nicht nur vom Boot, sondern auch vom Ufer aus ins Wasser ausgeworfen wurden. Neben dieser Fangtechnik ist offenbar auch eine Reihe von anderen Geräten bzw. Anlagen wie Fischspeere oder Reusen zum Einsatz gekommen. Dazu gehört auch eine Lampe, die Fische durch den Schein des Lichts anlockte.
Eine bedeutende Rolle spielte das Eisfischen, das während der Wintermonate die eigene Ernährung sicherte und möglicherweise einen Zusatzverdienst einbrachte. Dabei wurden die Boote durch Schlitten ersetzt, in denen die notwendigen Werkzeuge transportiert wurden: eine Axt zum Aufschlagen des Eises, große Schleppnetze, Mistgabeln, mit denen die Netze unter der Eisoberfläche bewegt wurden, oder eine Haspel, die dem Bergen der Netze aus den Eislöchern diente.
In den beiden anderen Räumen des Erdgeschosses werden Gegenstände präsentiert, die in jedem kaschubischen Haushalt Verwendung fanden. Es gibt Messgefäße sowie Werkzeuge und Gerätschaften zum Aufbewahren, Bearbeiten und Zubereiten von Lebensmitteln sowie alle notwendigen Utensilien für die Hausarbeit. In der Regel ernährten sich Kaschuben sehr bescheiden und verwendeten Produkte, die sie selbst erzeugt bzw. hergestellt hatten. Ihre Ernährung basierte auf Feldfrüchten, insbesondere Getreideprodukten und Kartoffeln. Milch und Milcherzeugnisse waren von geringerer Bedeutung, und Fisch oder gar Fleisch wurden nur selten gegessen, meistens gesalzen oder geräuchert, und frisch eigentlich nur zu festlichen Anlässen. Zur Sammlung gehören selbstverständlicherweise auch Waagen, Mühlen, Kochgeschirr oder verschiedene Arten von Butterfässern sowie Schmuckteller, die als Einzelstücke jede Anrichte dekorierten. Bemerkenswert ist letztlich ein Ensemble von reichhaltig verzierten Holzmodeln, die der Butter nach ihrer Herstellung eine kompakte und ansehnliche Form gaben.
Eine Vielzahl von wertvollen Gefäßen, die in den Küchen wohl seltener zum regelmäßigen Gebrauch bestimmt waren, können im vierten und letzten Raum des unteren Geschosses bewundert werden, denn dort wird eine reiche Kollektion von Töpferwaren präsentiert. Die Kaschuben sind bis heute für die Herstellung ihrer mit traditionellen Mustern verzierten Keramik berühmt. Von dieser Kunst zeugen hier mannigfache Produkte der bekanntesten kaschubischen Töpferfamilien, der Meissners, Necels und Kaźmierczaks. Deren Krüge, Vasen, Schalen oder auch Kacheln variieren kunstreich die charakteristischen, in traditionellen Farben gehaltenen kaschubischen Motive des Sterns, der Tulpe, des Fliederzweigs oder der Fischschuppe.
Alltagskultur und Volkskunst
Weitere vier Räume befinden sich in der ersten Etage. Zunächst erreichen die Besucher eine Abteilung mit altem kaschubischem Spielzeug: Klappern, Karussells oder auch Windmühlen. Sie spiegeln oft Bewegungsabläufe oder Tätigkeiten der täglichen Arbeit auf dem Feld oder im Hause wider, als sollten Kinder schon von früh an auf das Erwachsenenleben vorbereitet werden.
Die Freunde der kaschubischen Musik kommen ebenfalls auf ihre Kosten, denn hier finden sich die Instrumente, die für die Region in hohem Maße spezifisch sind: der Burczybas (der „Brummtopf“), die „Teufelsgeige“ oder die traditionell von Schäfern und Fischern geblasene Bazuna, eine lange hölzerne Naturtrompete. Natürlich dürfen in diesem Zusammenhang auch die „kaschubischen Noten“ nicht fehlen, die bis heute beim Spracherwerb gute Dienste leisten.
In einem separaten Raum werden neben einer Sammlung von Münzen, deren Prägung historisch zum Teil bis ins 15. Jahrhundert zurückreicht, einzelne Beispiele von geschnitzten religiösen Skulpturen – darunter eine ausdrucksvolle Pietà – aufbewahrt, die in früheren Zeiten ihren Ort in einer der vielen kaschubischen Wegekapellen hatten.
Gleichsam als Vorspiel zu dieser Abteilung werden im Erdgeschoss bereits die traditionellen Kostüme und Maskaronen der Sternsinger präsentiert, deren „Gwiózdka“ – ebenfalls als ausgesprochenes Charakteristikum der Kaschubei – einen wesentlichen Bestandteil der Weihnachtsfeierlichkeiten bildet. Damit wird ein Umzug von kostümierten Menschen bezeichnet, die am Weihnachtsabend in die kaschubischen Häuser gehen und in typischen Rollen wie dem Storch, der Ziege, dem Schornsteinfeger oder dem Teufel ein phantasievolles Spektakel veranstalten.
Der weitere Rundgang führt zu wertvollen Zeugnissen des Kunsthandwerks. Zunächst fallen die Frauenhauben ins Auge. Die ältesten von ihnen stammen aus dem 17. Jahrhundert. Diese Kopfbedeckungen wurden naturgemäß vor allem von Damen der wohlhabenden Schicht getragen und gehörten zur Festtagskleidung. Sie waren meist aus teuren Materialien gefertigt, aus Samt, Brokat oder Taft, und wurden rundum reich bestickt. Dabei dominieren florale Motive wie Tulpen, Gänseblümchen oder Palmetten. Je aufwändiger diese Kopfbedeckungen gestaltet waren, desto höher stieg ihr Preis. Beispielsweise konnte ihr Wert, wie aus der Mitte des 19. Jahrhunderts überliefert ist, sogar über demjenigen einer Kuh rangieren.
Ein eigener Bereich widmet sich den Elementen der Mitgift, die auch in der Kaschubei vornehmlich aus Gegenständen des täglichen Gebrauchs bestand. Die Eltern und Verwandten trugen die Aussteuer, den Brautschatz, zusammen, und die zukünftige Braut sammelte Kleidungsstücke, Unterwäsche und Bettzeug in einer bemalten Truhe, die später praktischerweise auch als Sitzgelegenheit genutzt wurde und in der sich manchmal auch Geheimfächer für Wertgegenstände wie den Familienschmuck verbargen.
In diesem Umfeld finden sich zudem Beispiele der volkstümlichen Plastik, die in ihrem Formenreichtum und eigenwilligen Stil bis heute ein überall begegnendes Abzeichen kaschubischen Kunstgewerbes bildet.
Der letzte Raum der oberen Etage erweckt den Eindruck einer Zeitreise in die Vergangenheit. Dort wurde eine traditionelle kaschubische Stube mit all ihren Elementen detailgetreu eingerichtet. Zu den zahlreichen Möbelstücken, die realitätsnah arrangiert sind, gehört ein originell konstruiertes Kinderbett, das in der Länge variabel ist und dadurch der jeweiligen Körpergröße der Heranwachsenden angepasst werden kann. Ein weiteres ungewöhnliches Objekt ist an der Wand angebracht. Es handelt sich um eine Lederpeitsche (einen „pyzder“), die bei den jüngeren Mitgliedern einer Familie durchaus Furcht erregen sollte, weil sie zuweilen wohl bei Unartigkeiten tatsächlich zum Einsatz kam. Zu der Stube gehören schließlich auch Exempla der in der Kaschubei beliebten Hinterglasmalerei und deren Variante, der Spiegelmalerei.
Einen originellen Schlusspunkt der ganzen Abteilung setzt eine Sammlung von Schnupftabakdosen, die meistens aus Kuhhorn gefertigt und künstlerisch oft sehr aufwändig gestaltet sind. Diese speziellen Behälter belegen, welch große Verbreitung der Konsum von Schnupftabak gefunden hat und welch hohe Wertschätzung ihm gerade in der Kaschubei, und zwar bis in die Gegenwart hinein, entgegengebracht worden ist.
Die neuen Räumlichkeiten
Neben dem Hauptgebäude liegt, wie eingangs schon erwähnt, ein instandgesetztes und umgebautes früheres Wirtschaftsgebäude, das seit 2019 dem Kaschubischen Museum zur Verfügung steht und das neben einem Konferenzraum und großzügigen Flächen für Sonderschauen zwei zusätzliche Bereiche der Dauerausstellung beherbergt.
Dazu gehört zum einen die bereits genannte Schmiede, in der unterschiedliche Werkzeuge, Blasebälge, Drehbänke oder Schleifmaschinen gezeigt werden. Alle Objekte in „Basils Schmiede“ gehörten einst Bazyli Dąbrowski, einem waschechten kaschubischen Schmied, der sein Handwerk von den 1920er Jahren an bis zu seinem Tod im Jahre 1968 in Borek, in der Gemeinde Sullenschin (Sulęczyno), ausübte. Die originalen Gegenstände wurden dem Museum von Andrzej Dąbrowski, dem Enkel des Besitzers, geschenkt und können nun gleichermaßen die Erinnerung an den Großvater wie an das alte Handwerk des Schmieds bewahren.
Der zweite Bereich der Dauerausstellung besteht aus einer multimedial konzipierten Präsentation von auf Leinwand gedruckten Grafiken, die Małgorzata Walkosz-Lewandowska geschaffen hat. Den Titel – „Die kaschubisch Moderne erwächst aus ihren Wurzeln“ – machen die einzelnen Werke sinnfällig: Auf märchenhafte Weise zeigen sie nicht nur die Geschichte der Kaschuben, sondern auch deren Bräuche, religiöse Vorstellungen und Legenden.
Die Museumsdirektorin Barbara Kąkol hat als Kuratorin dafür gesorgt, dass sich – technologisch avanciert – die Realität der Bilder virtuell erweitern lässt. Auf der Grundlage der gezeigten Elemente können die Besucher 3D-Ansichten generieren und dabei ebenso unterhaltsam wie lehrreich das Märchen über die Kaschubei eigenständig weiterentwickeln.
Neben seiner Sammlungs- und Ausstellungstätigkeit entfaltet das „Kaschubische Museum“ ein breites Spektrum an Bildungs- und Kulturangeboten und gibt auch eine Reihe von einschlägigen Publikationen heraus. Insgesamt bildet es einen wichtigen Faktor im kulturellen Leben der Stadt und der Region. Dazu gehören Vorträge, interessante Wechselausstellungen, Vernissagen heimischer Künstler, Wettbewerbe oder Workshops für Kinder. Großer Beliebtheit erfreut sich auch das „Festival des Kaschubischen Likörs“ sowie der regelmäßige Folklore-Markt, bei dem man Produkte der traditionellen regionalen Küche kennenlernen – und probieren – kann oder auch in die Geheimnisse der alten Handwerkskunst eingeweiht wird.
Auf verschiedenste Weise gelingt es dem Museum somit, Menschen an den Reichtum der alten und weiterhin lebendigen kaschubischen Kultur heranzuführen. Dabei gehört es zu den besonderen Vorzügen des Hauses, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freundlich, entgegenkommend und warmherzig auftreten und als Motto anscheinend das kaschubische Sprichwort „Bëlné słowò òtmikô serce“ – „Ein gutes Wort öffnet das Herz“ – auserkoren haben, denn an solchen „guten Worten“ mangelt es dort – wie übrigens auch in der gesamten Kaschubei – gewiss nicht.