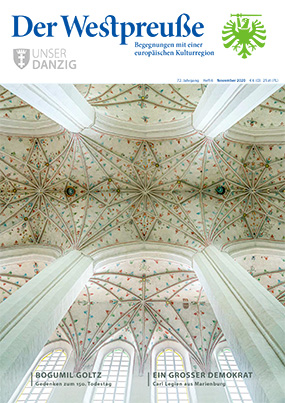Leben und Werke des westpreußischen Schriftstellers Bogumil Goltz (1801–1870)
Von Andreas Koerner
Der verblassende Nachruhm eines hochgeschätzten Autors
Am 12. November 1870 starb der Schriftsteller Bogumil Goltz in Thorn an der Weichsel. Seinen letzten Weg begleiteten viele Menschen. In der Bromberger Zeitung vom 22. November wurde darüber berichtet : Seine Leiche sei würdevoll gewesen, denn sie machte, „wie sie mit dem weißseidenen Sterbehemde bekleidet, auf dem olympischen Haupte einen Lorbeerkranz, einen andern in der linken Hand, während die rechte einen schönen Palmzweig hielt, den Eindruck eines marmornen Kunstwerks“. Die Zeitung schrieb weiter : „Das Leichenbegängnis unseres Bogumil Goltz gab einen erhabenen Beweis der hohen Achtung, welche dem hohen Geiste des Mannes“ gezollt wurde.
Der 1801 in Warschau geborene Autor war nach vielen verschiedenen Lebensstationen im östlichen Raum 1847 von Gollub an der Drewenz nach Thorn, seinem letzten Wohnort, gezogen. Der Coppernicus-Verein in Thorn ernannte „unsern großen Philosophen, Menschenkenner und Humoristen“ 1856 zum Ehrenmitglied. Auch nach seinem Tod ließ es dieser Verein nicht an Ehrungen fehlen. Darüber wurde in der Festschrift zum 50. Geburtstag des Vereins vom Jahre 1904 ausführlich berichtet. Dort heißt es zum Beispiel : „Zur Erinnerung an Goltz kaufte der Verein drei vom Bildhauer Rosenfeld hergestellte Gypsabdrücke an, und stiftete die Büste in das Zimmer des Magistratsdirigenten, die Totenmaske in das städtische Museum, und das Medaillonbild in den Saal der Stadtverordneten.“ Es wurde eine Gedenktafel gefertigt, die „in sein Haus in der Tuchmacherstraße eingesetzt, und am 20. März, seinem Geburtstage, mit einer angemessenen Feierlichkeit enthüllt“ wurde. Es wurden Gedenkreden gehalten und gedruckt : zu seinem Tode, zur 10. Wiederkehr seines Todes und auch 1901, zu seinem 100. Geburtstag.
Als Theodor Kuttenkeuler 1913 seine Dissertation Bogumil Goltz : Leben und Werke vorlegte, konnte er die gesamte schriftliche Hinterlassenschaft des Autors durchforsten, die sich damals in Privatbesitz befand. Diese vom Coppernicus-Verein herausgegebene und im Verlag Kafemann in Danzig veröffentlichte Arbeit bildet ein Fundament der Kenntnisse über Goltz. 1926 erschien in den Mitteilungen des Copernicus-Vereins Arthur Semraus Aufsatz „Bogumil Goltz und die Frauen“. Darin erfährt man auch etwas von jüdischen Kaufmannsfrauen, denen Bogumil Goltz eng verbunden war. Dieser Aufsatz gibt insgesamt tiefere Einblicke in die kulturellen und gesellschaftlichen Verhältnisse des 19. Jahrhunderts.
1938 erschien in der in Posen verlegten Deutschen wissenschaftlichen Zeitschrift für Polen ein Bericht von Reinhold Heuer „Aus unveröffentlichten Briefen von Bogumil Goltz“. Diesen Bestand hatte die Städtische Copernicus-Bibliothek in Thorn drei Jahre zuvor erworben. Es handelt sich dabei um 27 Briefe des Schriftstellers an Emil Kuh in Wien, der vor allem als Biograph von Friedrich Hebbel bekannt geworden ist und der Goltz bei seinen Lese- und Vortragsreisen in Österreich unterstützt hatte.
Als Ergebnis des Ersten Weltkrieges war Thorn als Teil des „polnischen Korridors“ zum neu erstandenen Polen gekommen. Durch Abwanderungen nahm die Zahl der Deutschen in diesem Raum ab. Die Folgen des Zweiten Weltkrieges waren noch einschneidender. Die Gedenktafel am Wohnhaus verschwand, und der Grabstein von Bogumil Goltz auf dem Sankt-Georgs-Friedhof wurde gemeinsam mit den meisten anderen deutschen Grabsteinen zerstört. Von den in den Westen geflohenen Deutschen übernahmen einige die Aufgabe, die Erinnerung an die verlorene Heimat zu pflegen. Dazu gehörten auch häufiger Texte über den Schriftsteller Bogumil Goltz, die hauptsächlich im Westpreußen, in den Ostdeutschen Monatsheften und im Westpreußen-Jahrbuch veröffentlicht wurden. Besonders taten sich dabei Werner Schienemann und Rudolf Trenkel hervor. Diese ältere Generation der Thorner Goltz-Freunde ist inzwischen verstorben, und so ist es allmählich um diesen westpreußischen Schriftsteller recht still geworden.
29 unruhige Jahre im Leben des Bogumil Goltz
Bogumil Goltz war – am 20. März 1801 – in Warschau geboren worden, weil sein Vater Karl Gottlieb Goltz 1795 als Stadtgerichtsdirektor, d. h. als Leiter des Justizwesens, nach Warschau gekommen war. Bei der dritten Teilung und damit Auflösung Polens hatte Preußen 1795 auch noch fast ganz Masowien erhalten und sich als „Südpreußen“ einverleibt. Bogumil war als viertes Kind der dritte Sohn seiner Eltern. Seine Mutter kam mit dem lebhaften Jungen nicht zurecht, so dass er zunächst vorwiegend der „Neumannschen“, einem Hausfaktotum, überlassen war. Als er gerade sechs Jahre alt war, kam er, der den Eltern weiterhin als zu unbändig erschien, zu einer befreundeten Familie nach Warschau in „Zucht und Pflege“. Diese Familie zog allerdings schon im Frühjahr 1807 nach Königsberg in Ostpreußen, so dass Bogumil nun dort die Hospitalschule auf dem Oberhaberberg besuchte. Nach zweieinhalb Jahren kam er als Sextaner in die Stadtschule auf dem Kneiphof. Da die Pflegeeltern mit dem wilden Knaben aber nicht mehr zurechtkamen, mussten die Eltern Abhilfe schaffen, und so schrieb der Vater am 15. September 1810 einem Verwandten halb scherzhaft : „Ich habe Bogusch zum Prediger Jackstein nach Klein-Tromnau geben müssen. Will der ihn nicht behalten, so kommt er nach Graudenz ins Zuchthaus.“
Um sein mageres Einkommen als Dorfpfarrer aufzubessern, hatte Jackstein ein Knabenpensionat eingerichtet. Dort kam Bogusch als sechster – und jüngster – Knabe unter. Im ländlichen Klein-Tromnau, Kr. Rosenberg, konnte er sich offenbar richtig austoben und entfalten. Der auch im Ort beliebte Pfarrer fand wohl einen guten, von Verständnis geprägten Kontakt zu ihm, denn nach mehr als 35 Jahren erinnert sich der frühere Zögling noch an Jackstein und widmet ihm, „seinem liebevollen Erzieher, Ihm, dem guten Genius seiner Kindheit, dem stillbescheiden fortwirkenden Menschenfreunde, dem echten Mann Gottes“, seine erste Veröffentlichung, das Buch der Kindheit, „in herzinnigster Liebe und Verehrung“.
Nach nur eineinhalb Jahren musste Bogumil aber diesen Hort wieder verlassen und kam 1812 nach Marienwerder, wohin sein Vater 1808 / 09 versetzt worden war, weil „Südpreußen“ 1807 bekanntlich aufgegeben werden musste. Sein Vater nahm ihn in seine herbe, aber keinesfalls herzlose Obhut. Drei Jahre später, 1815, ging der Sohn aber wieder nach Königsberg zurück, dieses Mal auf das Friedrichskolleg, und wurde vom Oberlehrer Bujack aufgenommen. Er war freilich immer noch der wilde, unangepasste Junge ; und als er 1816 zum Prediger Steffen in Pension kam, wurde das Leben für ihn unerträglich. Auf dringliches Bitten hin erreichte er bei seinem Vater, dass er die Schule verlassen durfte, um Landwirtschaft zu erlernen.
Im Mai 1817 trat er als Eleve seine Ausbildung auf dem russischen Kronen-Domänenamt Ciechocin an der Drewenz an. Der Pächter war Karl Friedrich von Blumberg, ein Jugendfreund des Vaters. Im Domänenamt gab es allerdings auch viel Verwaltungsarbeit zu erledigen, womit sich Goltz nicht recht anzufreunden vermochte.
1819 leistete er seinen Wehrdienst als Einjähriger beim Infanterie-Bataillon der Festung Graudenz ab, wo er sogar zum Unteroffizier befördert wurde. Danach gab ihm von Blumberg zwar den Posten eines Wirtschafters, wegen Streitigkeiten ließ er sich zum Sohn seines Chefs auf das benachbarte Gut Birglau versetzen. Aber auch dort bekam er Streit. Der Vater machte sich um die berufliche Zukunft seines Sohnes zunehmend Sorgen und dachte, dass er Beamter werden könnte. Diesem Rat suchte Bogumil unter der Anleitung seines Schwagers, des Postrendanten Zimmermann in Thorn, Folge zu leisten. Nach wenigen Wochen gab er diesen Plan allerdings wieder auf : Büroarbeit lag ihm einfach nicht.
1821 reiste er zu seinem Bruder Karl nach Fürstenwalde in der Mark, der dort das Bürgermeisteramt verwaltete ; alle Bemühungen, dort Fuß zu fassen, scheiterten jedoch ebenfalls. Daraufhin bekam Bogumil die Erlaubnis, Privatstunden bei Primanern des Thorner Gymnasiums zu nehmen, um sich auf ein Universitätsstudium vorzubereiten. Überdies fuhr er nach Breslau, nahm dort Unterricht in klassischen Sprachen und erwarb vor einer Prüfungskommission das Zeugnis der Reife. Im Frühjahr 1822 schrieb er sich an der Universität Breslau als Theologiestudent ein, wandte sich aber, nachdem er dem Philosophen, Naturforscher und Dichter Henrik Steffens (1773–1845) begegnet war, der Philosophie zu ; aber auch diese neue Neigung blieb instabil : Schon nach zwei Semestern verzichtete er auf alle weiteren akademischen Ausbildungswege – und wollte wieder Landwirt werden.
Ein wichtiger Grund für diese Entscheidung war vermutlich, dass er sich verliebt hatte, und zwar in Amalie Josephine, die älteste Tochter von Karl Friedrich von Blumberg. Der schnellste Weg, sie zu heiraten, war es, zur Landwirtschaft zurückzukehren. Sein Vater und der Vater seiner Braut kauften ihm im Frühling 1823 für 14.000 Taler das Rittergut Lissewo bei Gollub an der Drewenz. Am 30. Juni 1823 schon heiratete Bogumil seine damals 18-jährige Amalie Josephine. Allerdings blieb das junge Glück nicht ungetrübt, denn Bogumil Goltz forderte bei einer Wehrübung seinen Vorgesetzten zu einem Duell und wurde daraufhin zu einer dreijährigen Festungshaft verurteilt. Deshalb verpachtete er sein Gut. Nach sechs Monaten wurde er aber vom König begnadigt, so dass ihm die restliche Zeit in Graudenz erspart blieb. Nun zog Bogumil gemeinsam mit seiner Frau nach Breslau, um weitere Studien zu treiben, fand dort allerdings auch nicht zu größerer Stetigkeit. Nach Ablauf der Pacht versuchte er sich neuerlich als Landwirt, entschloss sich nach anhaltenden wirtschaftlichen Misserfolgen letztlich, sein Gut 1829 gegen eine Leibrente von 400 Talern auf Lebenszeit zu verkaufen. Auf der Suche nach einem möglichst billigen Wohnort, in dem er von seiner kleinen Rente leben könnte, entschied er sich für Gollub.
Ein Autodidakt gelangt zu Erfolg und Ruhm
Ab 1830 wohnte der noch nicht 30-jährige Bogumil Goltz nun als eine Art Frührentner in Gollub. 1831 verbrachte er zwar die drei Sommermonate in Breslau, aber hielt sich sonst stets in Gollub auf. Er betrieb breit angelegte Selbststudien auf mannigfachen Gebieten. Karl Rosenkranz, Philosophieprofessor in Königsberg, meinte dazu : „Es ist grenzenlos, was er in seiner Einsamkeit alles in sich durchgearbeitet hat.“ Er studierte und schrieb, und vieles von dem, was in seinen späteren Büchern zu lesen ist, nahm von hier seinen Ursprung. Nach mehreren Jahren hatte er einige Manuskripte abgeschlossen und machte sich ab 1838 in Berlin, Königsberg oder Danzig auf eine – lange Zeit vergebliche – Suche nach einem Verleger.
Ein ganz eigenes Thema schlug der Schriftsteller freilich mit seinen Schilderungen und Reflexionen der Kindheit an. Hier gelangte er zu Sicht- und Darstellungsweisen, die bald große Aufmerksamkeit erregten. 1843 las er in Königsberg beim Schulrat Lucas erstmals Teile aus seinem späteren Buch der Kindheit vor. Sie müssen wohl sehr positiv aufgenommen worden sein, denn er setzte die Arbeit daran intensiv fort. Auch für dieses Projekt fand er weder in Königsberg noch in Berlin einen Verleger ; dann aber konnte es 1847 bei Zimmer in Frankfurt am Main erscheinen. Die gute Resonanz dieses Buchs ermutigte Goltz, als freier Autor schon im selben Jahr nach Thorn umzusiedeln.
DAS SUJET VON KINDHEIT UND JUGEND Das Buch der Kindheit, auf das er 1852 Ein Jugendleben, ein drei Bände umfassendes biographisches Idyll aus Westpreußen, folgen ließ, wurde Goltzens nachhaltigster Erfolg und sichert sein literarisches Weiterleben bis heute. 1908 brachte es Karl Muthesius (1859–1929) in der Buchreihe Bibliothek pädagogischer Klassiker heraus. Friedhelm Kemp (1914–2011) begann 1964 bei Kösel die Reihe Lebensläufe. Biographien, Erinnerungen, Briefe mit einer Neuausgabe, die ungefähr fünf Sechstel des Buches enthält ; und 1992 – um noch ein weiteres Beispiel zu nennen – veröffentlichte der in Breslau lehrende polnische Germanist Marek Zybura ( * 1957) in der bei Nicolai verlegten Reihe Deutsche Bibliothek des Ostens ein Drittel des Buches unter dem Titel Kindheit in Warschau und Königsberg. Darüber hinaus haben einzelne Kapitel unter wechselnden thematischen Aspekten in mannigfache Anthologien Eingang gefunden und halten auf diese Weise die Erinnerung an Bogumil Goltz wach.
Bis heute können sich die Leserinnen und Leser nicht dem besonderen Reiz entziehen, den das Buch der Kindheit (wie auch Ein Jugendleben) ausübt. Der Autor versteht es, die Kindheitsphase mit ihrer ganzheitlichen Weltwahrnehmung, mit ihren Träumen, Phantasien und intensiven Erlebnissen ernst zu nehmen und voller Respekt zu rekonstruieren. Diese hohe Wertschätzung der Kindheit erinnert an die Einsichten, die Jean Paul 1807 in seiner Schrift Levana oder Erziehlehre niedergelegt hatte. Im § 55 heißt es beispielsweise:
Der Lehr- und Brotherr der Kleinen handelt immer, als sei das ordentliche Leben des Kindes als Menschen noch gar nicht recht angegangen, sondern warte erst darauf, daß er selber abgegangen sei und so den Schlußstein seinem Gewölbe einsetze. […] Himmel ! Wo ein Mensch ist, da fängt die Ewigkeit an, nicht einmal die Zeit. Folglich ist das Spielen und Treiben der Kinder so ernst- und gehaltvoll an sich und in Beziehung auf ihre Zukunft als unseres auf unsere.
Im Spannungsfeld zwischen der Vergegenwärtigung des kindlichen Empfindens, Wollens und Denkens und der Reflexion des Erwachsenen, der diesem früheren Zustand sehnsuchtsvoll nachspürt, gewinnt jedes noch so banal scheinende Detail, jeder Vorgang in der Natur, jeder auftretende Charakter oder jede atmosphärische Stimmung, eine eigene Bedeutung, einen spezifischen Wert. Getragen und durchpulst werden diese Ausführungen zudem von einer starken Begeisterung, die bei Goltz oft mit einer Rhetorik des emphatischen, wenn nicht enthusiastischen Sprechens verschwistert erscheint. Diesen Zusammenhang akzentuiert der Schriftsteller Friedrich Lienhard (1865–1929), der 1904 für die ansprechende Reihe Bücher der Weisheit und Schönheit eine Auswahl von Goltz-Schriften besorgte und in seinem Vorwort aus einem Brief von Schiller an seinen Dresdner Freund Christian Körner den folgenden Satz zitiert : „Danken Sie dem Himmel für das beste Geschenk, das er Ihnen verleihen konnte, für das glückliche Talent zur Begeisterung. Sehen Sie, bester Freund, unsere Seele ist für etwas Höheres da, als bloß den uniformen Takt der Maschine zu halten.“
Diese „Begeisterung“ bedeutet für Goltz keineswegs eine Distanzierung von den Niederungen des Lebens, ein Streben nach dem Höheren, sondern eine vereinheitlichende Kraft, die beide Bereiche umfasst und zur Synthesis bringt. Diese Grundvorstellung formuliert er im Kapitel „Allerlei Historien und Kinder-Erlebniß“ des Buchs der Kindheit (im Abschnitt „Meiner Mutter Amme“) folgendermaßen
(S. 375f.) :
Alles Gedeihen komm hienieden von unten und oben zugleich. Wo nicht Materie und Geist, Herz und Vernunft, das Natürliche und das Uebernatürliche, das Gemeine und das Ungemeine, wo nicht Volks- und Herrenleben, Schul- und Mutterwitz und alle Gegensätze ineinander spielen und mitsammen im Geschäft sind, da gibt es über kurz oder lang immer nur ein Extrem der Brutalität oder der Ueberfeinerung, eine Barbarei der Rohheit, oder eine solche der Hypercivilisation !
Diese Überzeugung steht im engsten Zusammenhang mit einem unverbrüchlichen humanistischen Menschenbild : „Wo ich immer nur einen echten Menschen und einen glücklichen Genius kennen lernte, da fand ich auch in ihm einen geborenen Menschenfreund.“ Dabei wendet sich Goltz auch ausdrücklich den unteren Schichten zu und begegnet ihnen mit Verständnis und nicht zuletzt Sympathie. So lässt er seine Leserinnen und Leser innerhalb des genannten Abschnitts „einen Blick in die Armuth und Elendigkeit des Volkes thun“ (S. 380f.): „Mir gegenüber wohnen verarmte Handwerksleute, blutarme Menschen.“ Deren Kinder „verführen dicht unter meinem niedrigen Fenster einen Lärmen und Skandal, daß ich weder schreiben noch lesen kann“. Nachdem sogar eine Fensterscheibe zu Bruch gegangen ist, macht der Autor der Mutter „einige menschenfreundliche Vorschläge zu einer mehr handgreiflichen Handhabung der Kinderzucht“. Davon lässt er aber „bald beschämt und betroffen“ ab, weil ihm „die Frau in ruhiger Weise“ entgegnet:
Bester Herr, das sagen Sie so, aber ich kann meine Kinder nicht ziehen. Sie machen Teufelszeug, es ist wahr, aber wie soll ich sie schlagen, wenn ich ihnen nicht halbsatt zu essen geben kann, und mein Mann, wenn der betrunken ist, so schlägt er sie schon halb todt. Es ist ja nur Haut und Knochen an den Bälgen. Mir will manchmal das Herz brechen, wenn ich bedenke, wo die Kinder noch die Lust und die Kraft herbekommen, mit hungrigem Magen und halbnackend so viel Spektakel zu machen. Was sollt’ denn aus ihnen werden, wenn sie sich das Elend zu Kopf nehmen möchten ?
Angesichts dieser Einsicht gelangt der Autor zu dem Schluss: „Ohne Sympathie aber für das arme Volk und die dienende Klasse ist der sogenannte Gebildete und der Vornehme nur eine todte Puppe und kein richtiger Mensch!“
DIE ERKLÄRUNG DER WELT Von seinem schriftstellerischen Durchbruch an hat Bogumil Goltz eine umfangreiche Reihe von Büchern veröffentlicht, die auf breites Interesse stießen und zum Teil in mehreren Auflagen erschienen sind. Die Digitalisierung ganzer Bibliotheken hat dazu geführt, dass diese Schriften mittlerweile im Internet wieder leicht zugänglich geworden sind. Wenn man sich auf die Lektüre dieser Schriften neuerlich einlässt, treten zwei Schwerpunkte hervor, an denen Grundlagen des Denkens und Argumentierens veranschaulicht werden können.
1847, im gleichen Jahr, in dem Das Buch der Kindheit erscheint, verlegt Heinrich Zimmer in Frankfurt a. M. auch eine Monographie, die eines der Grundthemen anschlägt. Ihr Titel lautet : Deutsche Entartung in der lichtfreundlichen und modernen Lebensart. An den modernen Stichwörtern gezeigt. Darin wendet sich Goltz entschieden gegen die einseitige, ungebändigte Freisetzung „aufklärerischer“ Bemühungen (S. 84):
Die neuen Propheten […] gefallen sich einzig und allein nur in Einem : In einem Extrem von Verstand, von Kälte, von Unruhe, von Modernität und Säkularisation, in einer Verläugnung alles Natur- und Gottesinstinkts, in einer Ablösung aller Geschichten Himmels und der Erden, in dem künstlichen und grellen Phosphorlicht einer Societäts-Philosophie und Schulvernünftigkeit, in einem Lichte, an welchem die uralte Finsterniß viel unheimlicher sichtbar wird, als im natürlichen Lichtdunkel der alten, der biblischen und historischen Zeit.
Dass Goltz, der sich früher dem Studium der Theologie zugewandt hatte, den Glauben vor aller „fortschrittlichen“ Religionskritik und Zergliederung der „neuen Propheten“ schützen will, beruht auf einer konservativen Grundhaltung des Autors, die nicht nur auf Dogmen basiert, sondern aus dem individuellen Erlebnis des Wunderbaren gespeist wird und sich durch die Vorstellung einer Einheit, die auch Gegensätze zu überwölben vermag, Übergänge in die Philosophie offenhält (S. 161) : „All überall ein Wunder, das uns ersticken, das uns blödsinnig oder toll machen müsste, wenn es noch etwas anderes gäbe als eben das Wunder! Oder sollen wir uns gegen Seele und Leib empören, blos weil wir nicht demonstriren können, wie Beide Eines und Zwei zugleich sind.“
Der Respekt vor der Gesamtheit der als Schöpfung verstandenen Erscheinungswelt fordert einerseits eine universelle humanistische Orientierung des Menschen, wie sie sich z. B. schon in der dezidierten Wahrnehmung der „Armuth und Elendigkeit des Volkes“ gezeigt hat ; andererseits ist er ein ständiger Quell ehrfürchtigen Staunens. In der zweibändigen Publikation Zur Geschichte und Charakteristik des deutschen Genius. Eine ethnographische Studie, die 1864 als 2. Auflage der Studie über Die Deutschen (1860) erschienen ist, rekurriert Goltz im XVII. Kapitel – „Die deutsche Mystik und die moderne Lichtfreundlichkeit mit Glossen versehen“ – auf seine soeben zitierte Aussage, dass „All überall ein Wunder“ zu bestaunen sei, und fügt nun die folgende Beobachtung und Reflexion an (II. Bd., S. 154) :
Eben rennt mir eine zinnoberrothe Spinne über das Papier, die so groß ist wie ein Stecknadelkopf, als ich der tausendfixen Creatur mit dem Finger nahe komme, steht sie plötzlich erschrocken still, stellt sich, auf den Rücken gelegt, regungslos todt. – Also ein Wurm, welcher alle Augenblicke, aus den spielenden Bildkräften der Natur hervorgeht, der wehrt sich seines Lebens, der fühlt sich von anderm Dasein unterschieden, der hat Todesschreck und Lebenslisten, der hat Nerven-Apparate, ist eine Welt im Kleinen, und doch nur aus ein Paar Stäubchen in ein Paar Augenblicken zusammengeblasen ; begreife das, beruhige sich darüber wer will und kann, mich machts gläubig und dumm.
Die feste moralische, christlich-humanistische Botschaft des Autors ist eng mit einer Weltsicht verschränkt, die von einem wohlgeordneten, typologisch erfassbaren Kosmos ausgeht und die den zweiten Fluchtpunkt seiner Schriften bildet. Ob Goltz, wie soeben zitiert, die „Charakteristik des deutschen Genius“ erläutert, ob er – unter dem Titel Der Mensch und die Leute – die „Charakteristik der barbarischen und der civilisirten Nationen“ (1858) erschließt oder ob er 1859 ein Buch Zur Charakteristik und Naturgeschichte der Frauen publiziert, das bis 1904 immerhin noch sechs Auflagen erlebt – stets ist sein Blick auf das Ganze gerichtet und stets gehen seine systematischen Untergliederungen widerspruchsfrei und restlos auf.
Dabei bringt er eine Fülle aufschlussreicher psychologischer Beobachtungen ein, die er – wie schon in den Büchern zu Kindheit und Jugendzeit – mit großer Sensibilität anstellt und schildert ; zugleich freilich geht er von nationalen Hierarchien aus, die dem Deutschtum regelmäßig den obersten Rang zuweisen. Diesen Doppelaspekt soll das folgende Beispiel aus Der Mensch und die Leute erhellen. Im Abschnitt „Zur Natur- und Kulturgeschichte der Polen“ (S. 376–413) diskutiert Goltz unter vielerlei Aspekten auch die Differenz zwischen deutschen und polnischen Tänzern ein. Dabei skizziert er variantenreich und mit wohlgesetzten satirischen Strichen, dass „die deutsche Gründlichkeit und Schwerfälligkeit, die deutsche Oekonomie, […] beim Tanz-Vergnügen keine lustige Figur“ macht (S. 382). Dieser „Karikatur-Wahrheit“ (ebd.) setzt er sein Bild des Polen gegenüber : Bei ihm erscheint „die ganze Gestalt im Schmelz der Leidenschaft und des Vergnügens“, und man begreift, „daß seine Körperbewegungen nur die Versinnbildlichung des rhythmischen und idealen Lebens sind, welche die ganze Seele hingenommen hat“.
Diese entschiedenen Vorzüge in der Unbefangenheit und Natürlichkeit haben natürlich quasi ihren Preis ; denn zwangsläufig erweisen sich dann in Bereichen, in denen die Deutschen brillieren, erhebliche Defizite (S. 384) :
Für Alles, was Vernunft im engern und bestimmtern Sinne heißt, für Alles was zum Schematismus, zur Logik und Grammatik gehört, was Disziplin, System und Methode genannt wird, hat diese allzu natürliche Polen-Race nur ein unmächtiges Organ, eine schwächliche Constitution.
Wie in einem Brennspiegel zeigt dieser kurze Absatz, wie vorzüglich das typologisierende Verfahren die Welt erschließt und „erklärt“ : Sprachlich virtuos, höchst belesen und in abwechslungsreichen Arrangements schildert Goltz die „Charakteristik“ von Menschen, Geschlechtern und Völkern – und fällt dabei Urteile, bei denen er sicher sein kann, dass sie mit den Vor-Urteilen seiner Leserinnen und Leser aufs Schönste übereinstimmen.
Dies dürfte der wichtigste Grund dafür sein, dass diese Titel heute vor allem noch aus kulturhistorischen Interessen heraus rezipiert werden: In langwierigen Prozessen hat sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts allmählich die Erkenntnis durchgesetzt, dass das meiste von dem, was vermeintlich als naturgegeben, als „charakteristisch“ gegolten hat, auf gesellschaftlichen Konventionen und ideologischen Konstruktionen beruht. Hinter diese Einsicht können wir bei unserer Goltz-Lektüre schwerlich noch zurück.
DER RHAPSODE Das Bild von Bogumil Goltz wäre lückenhaft, wenn nicht auch seiner Tätigkeit als Vortragskünstler gedacht würde. Schon vor der Veröffentlichung seines ersten Buches muss ihm aufgefallen sein, dass er zu öffentlichen Auftritten Talent hatte – und dass sich damit Geld verdienen ließ, das er gut gebrauchen konnte, zumal er zwei Pflegetöchter hatte und arme Verwandte unterstützte. Mitte des 19. Jahrhunderts fanden solche Veranstaltungen große Resonanz, weil sich dafür ein hinlänglich großes – und zahlungswilliges – bürgerliches Publikum gebildet hatte, das sich gerne in unterschiedlichen Kunst-Sparten von „Virtuosen“ faszinieren ließ. Zudem war diese Zeit – in der 1851 die erste Weltausstellung veranstaltet wurde – darauf aus, Verkehrswege zu erschließen, und eröffnete dadurch Chancen zu weiträumigen und flexiblen Reiseplanungen. So fuhr Bogumil Goltz 1848 nach Frankreich, wo er mit Victor Hugo zusammentraf, sowie nach London und unternahm ein Jahr später sogar eine Reise, auf der er Ägypten, Italien und Sizilien besuchte. (Aus diesen Erfahrungen resultiert die 1853 erschienene Monographie Ein Kleinstädter in Ägypten.) Darüber hinaus absolvierte er – seit 1860 fast Jahr für Jahr – regelrechte Vortragstourneen, die ihn durch den gesamten deutschsprachigen Raum – von Tilsit bis nach Pressburg und von Hamburg bis nach Triest führten. Dabei entwickelte Goltz einen gut organisierten Betrieb, bei dem Helfer vor Ort Säle anmieteten und entsprechende Anzeigen in den Zeitungen schalteten.
Bogumil Goltz war von stattlicher Erscheinung, hatte eine markante Hakennase und eine regional gefärbte Aussprache. – In seinen Lebenserinnerungen (postum 1906) schrieb Moritz Lazarus (1824–1903) :
Später kam Goltz nach Berlin und besuchte mich. Er war im Gespräch dadurch ausgezeichnet, daß er sich nicht nur wie in seinen Schriften durch große Übertreibung hervortat, sondern seine fulminanten Redensarten auch mit der größten Vehemenz hervorstieß. Dabei hatte er die Gewohnheit, wie viele Slaven, sehr sanft und nahezu tonlos eine Konversation zu beginnen, um dann allmählich in ein crescendo zu verfallen, das sich schließlich zu einem förmlichen Brüllen steigerte.
Zu seinem Publikum gehörten auch Friedrich Hebbel, Eduard Mörike, Gottfried Keller oder Hoffmann von Fallersleben, die dieser Rhetor zu beeindrucken wusste. Die frappierende Wirkung, die diese Veranstaltungen ausübten, wird noch in den folgenden Formulierungen spürbar, die Hyacinth Holland 1879, nur wenige Jahre nach Goltzens Tod, in dessen Würdigung für die Allgemeine Deutsche Biographie (Bd. 9, S. 353ff.) fand :
Wo er auf seinen Wanderzügen erschien, überraschte und verblüffte er mit geplanten oder extemporisirten Vorlesungen, welche nicht selten zu fesselnden, immer neuen, sprudelnden socratischen Paroxismen anschwollen, bis der wunderliche Mann, welcher stundenlang und ausschließend das Wort geführt hatte, mit herzlichem Dank für die ihm gewährte köstliche Unterhaltung ebenso schnell wieder verschwand als er gekommen war. (S. 354 )
Diese Charakterisierung von Goltz als Rhapsoden berührt sich mit Hollands Einschätzung des Schriftstellers, bei dem ihm zwar „Maß und Form, der Alles verbindende klare Faden“ fehlen (S. 355), bei dem er – von dem auch schon der Haupttitel dieses Beitrags entlehnt ist – aber immerhin zu einer Einschätzung dieses vielgestaltigen Westpreußen gelangt, die hinter unsere Betrachtungen mit Fug und Recht einen würdigen Schlusspunkt zu setzen vermag (S. 354f.) :
Mit den von ihm verschleuderten Geistesfunken hätten ein Halbdutzend anderer Menschen immerhin ein hübsches Geschäft begründet, hätten sich bei einiger Industrie und Vorsicht rühmlich hervorgethan und wären am Ende gar noch „deutsche Classiker“ und in Miniaturausgaben unsterblich geworden. […] Sein Unglück war die Ueberfülle seines Geistes und seiner Kraft; sein größter Fehler, daß er damit nie haushälterisch zu Werke ging.
Wenn die Überfülle ein „Unglück“ und der verschwenderische Umgang mit den eigenen Gaben ein „Fehler“ gewesen sind, ist dies keineswegs das Schlechteste, was die Nachwelt über einen Schriftsteller sagen kann.