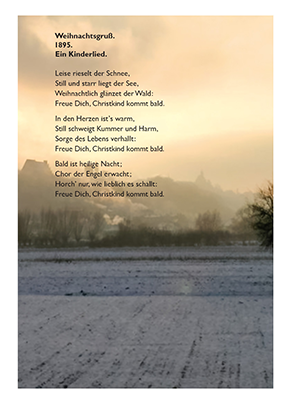Wer in den verfügbaren biographischen und bibliographischen Verzeichnissen nach Eduard Ebel recherchiert, wird von einer Vielzahl von Nennungen regelrecht überschwemmt, die sich immer nur auf einen einzigen Titel beziehen : „Leise rieselt der Schnee“ – in Gedichtsammlungen, Notenausgaben oder CD-Einspielungen. Für diesen „Weihnachtsgruß“ können dann auch verhältnismäßig leicht die Quelle (Gesammelte Gedichte) und das Jahr der Erstveröffentlichung (1895) identifiziert werden. Danach lässt sich dann auch ein differenzierteres biographisches Gerüst entdecken : Eduard Ebel wurde am 7. August 1839 in Preußisch Stargard geboren, studierte Theologie in Königsberg (Preußen) und wurde dort im Sommersemester 1857 Mitglied der Burschenschaft Germania; in den Jahren 1863/64 war er Oberhelfer (Pfarramtskandidat) am Rauhen Haus in Hamburg und wirkte später für mehrere Jahre (von 1866 bis 1869) als Pastor an der französisch-deutschen evangelischen Gemeinde Beirut. Danach wurde er Pfarrer der evangelischen Gemeinde in Graudenz und ging als evangelischer Superintendent 1895 nach Halle (Saale), wo er am 30. Januar 1905 starb.
Bereits diese eher nüchternen Daten wecken ein weitergehendes Interesse an diesem westpreußischen Theologen, der als Pfarramtskandidat am Rauhen Haus mit Johann Hinrich Wichern (1808–1881) und dessen Konzept zeitgemäßer diakonischer Arbeit in engen Kontakt gekommen ist, der immerhin drei Jahre lang im damals osmanischen Libanon zugebracht hat und sich schließlich so weit zu qualifizieren vermochte, dass er zum Ende seiner Laufbahn zum Superintendenten berufen wurde. Die zentralen Aspekte seines Lebens lassen sich an den wichtigsten der von Ebel veröffentlichten Schriften genauer erschließen.
Zum einen hat ihn der Aufenthalt im Libanon, den er im Alter von 27 Jahren kennenlernte, persönlich und in seinem Bibelverständnis nachdrücklich geprägt. Davon zeugt die 1873 in Königsberg erschienene Publikation Morgenland und heilige Schrift. In ihr sind zwei Vorträge zusammengefasst, die Ebel 1869 in Königsberg („In Zelten und Hütten des Morgenlandes“) bzw. 1872 in Danzig („Der Tag eines Propheten“) gehalten hat. Dort bekennt er am Ende des ersten Textes : „Der Orient ist ein Zauberland ; wer einmal seinen Boden betreten, ist mit tausend unlösbaren Banden an ihn gekettet und wird die Sehnsucht nach seinen ewigen Höhen nicht mehr in diesem Erdenleben los. Wenn nur das Verlangen nach dem Lande des Aufgangs auch zur nie verlöschenden Sehnsucht nach dem würde, der dort Mensch geworden und dessen heilige Worte auch das Licht gewesen, das uns diesmal bei Betrachtung jener Ferne geleuchtet hat“ (S. 27).
Zum andern bleibt Ebel – der sich kirchenpolitisch als Mitglied der Positiven Union gegen die aufkommende Liberale Theologie positionierte – zeitlebens dem Grundgedanken der Diakonie und mithin der Idee der christlichen Barmherzigkeit verbunden. In seiner Schrift Die soziale Frage und das Evangelium, die 1892 in Graudenz verlegt wurde, wendet er sich einerseits entschieden gegen einen – die Substanz des Christentums verfälschenden – reformerischen Pakt mit der Sozialdemokratie, andererseits prangert er aber auch die „Unterlassungssünden“ an, „deren sich insbesondere die evangelische Kirche schuldig gemacht hat“ : „Im Kampfe um die reine Lehre verlor die organisierte Kirche ihr Diadem, die Liebesarbeit unter den geistig und leiblich Armen“ (S. 21).
Diese beiden Faktoren, die Faszination durch den Orient und die leitende Kraft der Barmherzigkeit, spiegeln sich auch in einem kleinen Bericht über das Weihnachtsfest 1868 in Beirut wider, den Eduard Ebel der Johanniter-Ordens-Balley Brandenburg erstattet hat. Zugleich lässt der Autor das Bild einer Welt entstehen, die unerschütterlich von christlicher Glaubensgewissheit geprägt erscheint und in der ein harmonisches Miteinander von Nationen und Konfessionen zumindest noch nicht gänzlich undenkbar geworden ist. Deshalb lohnt es sich gewiss, diesen Beitrag auch heute einmal aufmerksam zu lesen.
Weihnachten im Johanniterhospital zu Beirut in Syrien
Es ist Weihnacht geworden im heiligen Lande. Nicht, wie daheim, mit Schnee und Regen, nein, wie zur Zeit, als die Hirten mit ihren Herden des Nachts auf den Feldern lagerten, – sonnenhell und warm; der Regen hat den Staub des Sommers hinweggewaschen; auf den Felsen sproßt das frische Grün mit Anemonen und Crocus durchwebt, die Rosenbüsche stehen in Blüthe und der Himmel spannt sich klar und duftig, wie Gottes Liebe und Güte, über Syriens Weihnachtspracht.
Um Mitternacht läuten die Glocken der katholischen Kirchen und rufen zur Messe. In der Maroniten- und Jesuitenkirche ist eine Grotte nachgebildet, in der das Christkindlein liegt, von frischen Blumen und unzähligen Lichtern umgeben; in dem weiten dämmerigen Raum ohne Bänke und sonstige Sitze drängt sich der männliche Theil der Gemeinde, während die Frauen nach orientalischer Sitte durch ein hohes Gitter getrennt unter ihren weißen Schleiern hinüberschauen nach der geschmückten Stätte. Vom Altar ertönt die Messe, aber unverständlich, wie wirres Gemurmel in die Gemeinde hinein – ich trete hinaus in die Nacht, durch die engen dunkeln Gassen den Heimweg zu suchen. Ueberall eilen noch Kirchgänger, jeder mit der klaren weißen Papierlaterne; dann und wann tönt der Zuruf der Negerwächter aus den Magazinen oder der Patrouille, die von der Kaserne her die Straße durchzieht – sie kennt keine Weihnacht und mustert neugierig die nächtlichen Kirchgänger, welche die Geburt des Jesu, Ibn Mirjam, feiern gehen.
Am 25. Vormittags ist der Gottesdienst der deutschen Gemeinde, die fast vollzählig versammelt ihr: „Dies ist der Tag, den Gott gemacht“ dem in Bethlehem Geborenen entgegenjauchzt. Fern von der Heimat eint Preußen und Deutsche, Schweizer und Dänen der eine Glaube; mit ihnen freuen sich Engländer und protestantische Araber, deren presbyterianische Gemeinde nur den Sonntag kennt, an dem Evangelium vom Christkinde, dem die Engel zujauchzen: „Ehre sei Gott in der Höhe, Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!“ Am Tische des Herrn feiern Mitglieder von fünf Nationen und eben so viel evangelischen Denominationen das Abendmahl; ein liebliches Friedensbild in dieser Zeit des Streites und der Unruhe.
Und nun kam der Nachmittag des ersten Feiertags, den wir zu einer Weihnachtsfeier im Hospital bestimmt hatten. In dem schönen Saal, den die Bilder Sr. Majestät des Königs und des Herrenmeisters, so wie eine Photographie des in Sonnenburg befindlichen Widmungsbildes, das die Johanniterritter in Syrien und auf dem Schlachtfelde darstellt, schmücken, war eine schöne Pinie aufgestellt, die und der Pascha von Beirut bereitwilligst geschenkt hatte. Sie strahlte im hellsten Lichterglanz, der auch die kleinen Gaben beleuchtete, welche am Fuße des Baumes ausgebreitet waren. Das reiche Geschenk eines Freundes der Anstalt hatte uns in den Stand gesetzt, allen Kranken eine Weihnachtsfreude zu bereiten. Da lagen die Mendile (Kopftücher für die Frauen), die Puppen für unsere arabische Kinderschar, Tabak in Beuteln für die Männer und für die Lesekundigen noch ein arabisches oder englisches Büchelchen; für unsere beiden Privatkranken war auch gesorgt worden. Die englische Lehrerin des Diakonissenpenisonats, welche schwer brustleidend, eine stille Stätte zum Sterben im fremden Lande bei uns gesucht hatte, und die Gott ergeben auf die Stunde ihrer Abberufung wartet, fand ihre Gabe, eben so wie die Frau eines Missionars, eine frühere amharische Prinzessin, die nach des Königs Theodorus Fall mit ihrem Mann hierhergekommen, im Hospital geblieben war, während ihr Gatte nach England und Deutschland reiste, um Mittel für neue Missionsunternehmungen in Abessinien aufzubringen.
Jetzt kamen die Kranken hinein, 30 an der Zahl. Den armen Churi Soliman, einen griechischen Priester, dessen Bein amputirt werden soll, tragen die beiden Wärter auf einem Lehnstuhl hinzu, andere kommen auf Krücken, sich unter einander stützend; der englische Matrose mit den tiefen Brustwunden, der mein besonderer Freund und ein eifriger Zuhörer meiner englischen Andachten ist, kann schon ziemlich gerade gehen, aber sein Nachbar, unser Stammgast, der gerade ein Jahr im Hospital ist, wird den Knochenfraß nicht los und zieht sich mühsam hinkend zur Thüre hinein. Die Frauen und Kinder folgen, viele augenkrank, die in den Hintergrund gesetzt werden, damit sie der Lichterglanz nicht blende, während ein erblindetes Mädchen, das nicht von der Herrlichkeit vor ihr ahnt, hineingeleitet wird und nun ängstlich in dem fremden Raum steht.
Auf der anderen Seite sind als Vertreter der hiesigen Protestanten Amerikaner, Engländer, Franzosen, Araber und Deutsche. Es sollte gezeigt werden, dass eine Stätte barmherziger Liebe allen Denominationen gehöre, deren Interesse an unserer Arbeit reger zu machen, der Grund der an sie ergangenen Einladung war. Darum sollten auch heute verschiedene Geistliche Zeugniß ablegen von der Bedeutung des Festes.
Wir stimmen das herrliche deutsche Lied an. Stille Nacht, heilige Nacht! Und nun redet Reverend Robertson in englischer Sprache von der heiligen Freude der Christen, mit den Armen und Elenden zusammen Feste zu feiern und vor Allem dieses Fest! Dann spricht der Senior der Mission, der ehrwürdige Dr. Thomson, ein hochverdientes Mitglied unseres Curatoriums, arabisch, und die kranken Kinder antworten in dem Liede, das ihnen Schwester Jacobine vorgesprochen: Li ism Jesu Halelu! Dem Namen Jesu Preis und ehr! Dann nahm der Unterzeichnete das Wort zuerst in deutscher Sprache, um auf den Segen hinzuweisen, den ein solch‘ gemeinsames Bekennen des Glaubens von Seiten der verschiedenen Nationen auch für die Stätte bringen müsse, auf der es geschah, um zu danken für alle Gnade Gottes im verflossenen Jahr, um der heimischen Wohlthäter zu gedenken und ihr Werk im heiligen Lande dem gnädigen Herrn zu befehlen. Mit französischem Gebet und Segen schloss die kurze Ansprache. Dann sprach als Vertreter der Araber, Missionar Wortabet, ein schönes, tief ergreifendes arabisches Gebet, um die Feier zu schließen. Die Schwestern und die Mitglieder des Vorstandes überreichten nun den Kranken ihre Gaben, die dafür mit orientalischer Ueberschwänglichkeit in Lob- und Dankpreisungen ausbrachen.
Die Nacht war gekommen, aber im Hause der Barmherzigkeit war es hell vom Lichterglanz und in den Herzen hellt von rechter, heiliger Weihnachtsfreude. O wie köstlich ist es, die Geburt deß zu feiern, der die Elenden und Kranken, die Mühseligen und Beladenen zu sich rief, wenn man ihm dienen darf und sich der Verheißung getrösten: Wohl euch, was ihr gethan habt dieser Geringsten einem, das habt ihr mir gethan!
Pfarrer Eduard Ebel
aus: Wochenblatt der Johanniter-Ordens-Balley Brandenburg, Berlin, Jg. 1869, S. 27f. (Nr. 5 vom 3. Februar 1869)