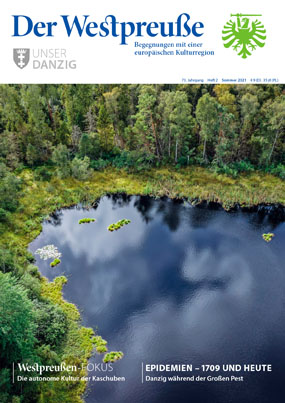Helga Schubert: Vom Aufstehen. Ein Leben in Geschichten. München: dtv, 2021
Vieles ist in den vergangenen Monaten über Helga Schubert geschrieben und gesagt worden, nachdem sie im Sommer 2020 den renommierten Ingeborg-Bachmann-Preis verliehen bekommen hat und darüber hinaus nun ihr jüngst erschienenes Werk für den Leipziger Buchpreis nominiert wurde. Es trägt den Titel der im letzten Jahr preisgekrönten Erzählung Vom Aufstehen, mit der die Autorin – „Ich bin ein Kriegskind, ein Flüchtlingskind, ein Kind der deutschen Teilung“ – ihren durch reiche Lebenserfahrung geschärften, abwägenden Blick auf Ein Leben in Geschichten beschließt. Die Form des Romans ist Helga Schubert, die immer wieder ihre große Bewunderung für die Erzählkunst Anton Tschechows betont, fremd; sie schätzt stattdessen kurze Prosa und gestaltet „Geschichten als Mikroskop. Geschichten als Spiegel“.
Die 29 eigenwertigen, in sich gerundeten Texte sind kunstvoll zu einem Corpus arrangiert, manche gleichen Miniaturen, und nur wenige werden auf mehr als zwanzig Seiten entfaltet. Sie folgen keinem biographischen Verlauf, sondern gehorchen allein der kaleidoskopartigen Verarbeitung verschiedener Motive: die Mutter, Erinnerung und Heimat, der Glaube und die Sünde, der Duft, das Schreiben. Vielfältige Wahrnehmungen können auf engstem Raum zu einer Erkenntnis verdichtet erscheinen, wie beispielsweise beim existentiellen Nachsinnen in den „Dämmerungen eines einzigen Tages“ oder in der assoziativ-flüchtigen Skizze „Wintersonnenwende“, mit der ein Schlaglicht auf das Leben in der DDR, ihrem „Zwergenland“, geworfen wird.
Dementgegen nimmt ihre Auseinandersetzung mit der eigenen Familie in der Geschichte mit der vielsagenden Überschrift „Eine Wahlverwandtschaft“ einen vergleichsweise breiten Raum ein. Dabei weiß Helga Schubert – gewiss auch mit dem geschulten Blick einer Psychotherapeutin –, Wesentliches und Prägendes zu benennen: die Flucht aus Hinterpommern; den Tod des Vaters, den sie nicht hat wirklich kennenlernen dürfen, dem sie aber stets nachtrauern wird; vor allem aber jenes vergebliche Flehen um die Liebe einer Mutter, die zwar die Urenkelin umschwärmt, der eigenen Tochter jedoch zumeist brüsk und gefühlskalt begegnet und ihr zum wiederholten Male – auch noch auf dem Sterbebett – die eigenen vermeintlichen „Heldentaten“ vorhält:
Erstens: Ich habe Dich nicht abgetrieben, obwohl dein Vater das wollte. Und für mich kamst du eigentlich auch unerwünscht. [Und dann nicht einmal ein Junge!] Wir haben deinetwegen im fünften Monat geheiratet. Zweitens: Ich habe dich bei der Flucht aus Hinterpommern bis zur Erschöpfung in einem dreirädrigen Kinderwagen im Treck bis Greifswald geschoben, und drittens: Ich habe dich nicht vergiftet oder erschossen, als die Russen in Greifswald einmarschierten.
Solche Sätze haben das Kind verstört, aber die Tochter ist letztlich daran nicht zerbrochen, denn sie hat sich ihnen entgegenstellen und dazu eine Haltung einnehmen können – gerade so, wie Helga Schubert auch politisch auf ihre Weise stets Haltung gezeigt hat. Der Ton bezüglich ihrer Mutter oder anderer Widrigkeiten ihres Lebens ist niemals klagend, schon gar nicht anklagend. Ihre Worte sind klar und zielgenau, bisweilen von einer tiefen Sinnlichkeit geprägt. Hellsichtig schaut sie auf das Erlebte und auf Menschen, die ihr begegnet sind, sei es in einem anrührenden Gespräch, in dem sie sogar die Tränen nicht zurückzuhalten vermag, oder sei es in einem nur scheinbar beiläufigen Blickwechsel im Friseursalon.
Immer wieder spürt der Leser eine unverbrüchliche Liebe zum Menschen, die – in einer Formulierung von Ingeborg Bachmann – „mit dem ganzen Wesen auf ein Du gerichtet“ ist. Einerseits mag diese Liebe in der festen Gläubigkeit der Autorin verankert sein, die, anders als die Mutter, von Kind an der Kirche angehörte und zu Zeiten der DDR als bekennende Protestantin auftrat (und aufgrund dessen während der Wende auf Vorschlag der Kirche hin zur Pressesprecherin des Runden Tisches berufen wurde). Ihre Texte sind durchzogen von Zitaten aus der Bibel und dem christlichen Liedgut, sowie von Fragen wie beispielsweise zum Verständnis von Ostern oder dem vierten Gebot. Der Glaube ist ihr offensichtlich eine starke Orientierungshilfe. Von unschätzbarem Wert aber war und blieb bis heute jene bedingungslose verlässliche Liebe, die das Kind durch die Großmutter väterlicherseits erfahren durfte, an jenem „Sehnsuchtsort“ fern der Mutter, der zum Inbegriff von Geborgenheit wurde: die Sommerferien lang umsorgt und verwöhnt, geliebt, in einer Hängematte zwischen Apfelbäumen liegend, vom Wohlgeruch des frischen Hefekuchens umgeben. „So konnte ich alle Kälte überleben. Jeden Tag. Bis heute.“
Dieser literarisch höchst einfühlsame Einstieg und das resümierende, wesentliche Motivfäden nochmals bündelnde Schlusskapitel „Vom Aufstehen“ umrahmen den Erzählband, schlagen damit gleichsam einen Bogen von der Kindheit zum Lebensabend. Dort geht es um den stillen Moment zur Morgenstunde, im Bett – wie ehemals in der Hängematte – zu ruhen, noch für einen Moment die Gedanken und Erinnerungen schweifen zu lassen und die „zwei Minuten in dieser wohligen Wärme und in diesem Lavendelduft“ zu spüren, bevor sie, die in über achtzig Jahren gelernt hat, auszuhalten, sich zu versöhnen und Frieden zu finden, tatsächlich „aufsteht“ und sich erfüllt von einer tiefen Liebe zu „ihm“, dem nun zu pflegenden Lebensgefährten, zuwendet: „Ich drehe mich vom Fenster um, er breitet die Arme zu mir aus. Alles gut.“ – Eine Geschichte kann, wie Helga Schubert in einer ihrer Reflexionen äußert, auch „ein sanftes Ausschwingen“ haben.