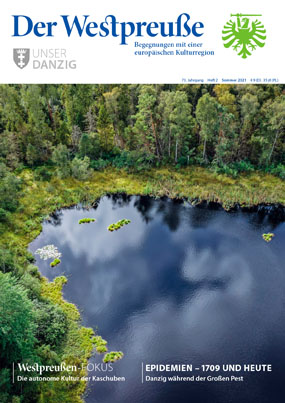Kriegsenkel geraten in den Schatten konfektionierter Literatur
Geschichte ist „in“, Filme und Serien mit historischen Themen boomen, und nicht zuletzt in der Literatur sind Werke mit biografisch-historischem Charakter seit einigen Jahren ein absoluter Trend. Vor allem Autorinnen veröffentlichen, inspiriert durch Erzählungen und Erinnerungen von Großeltern, Müttern, Tanten oder Bekannten, Romane, in denen sich die Komponenten Familie, Liebe, Schicksal mit realen Ereignissen mischen, unterlegt mit zeitgeschichtlich bedeutsamen Themen des 20. Jahrhunderts wie Nationalsozialismus, Krieg, Heimatverlust, Neuanfang in einem der beiden deutschen Staaten.
Eine „berührende Familiengeschichte“ über drei Generationen – so die Verlagswerbung – bietet auch Stefanie Gregg mit Nebelkinder an, eine literarische Aufarbeitung der Fluchterlebnisse ihrer schlesischen Großmutter und deren Nachfahren. Mit der Titelwahl orientieren Gregg und der Aufbau-Verlag sich dabei an dem von Sabine Bode geprägten Begriff, welcher die psychologische Problematik der transgenerationalen Weitergabe von Traumata in der Folge von Krieg, Flucht und Vertreibung bezeichnet. In wechselnden Kapiteln erzählt der Roman von Käthe und Selma, die mit ihren Kindern im Januar 1945 Breslau verlassen und in Bayern neu anfangen müssen, sowie auf einer Gegenwartsebene von Käthes Tochter Anastasia und der Enkelin Lilith.
Die dreizehnjährige Anastasia, die sich in Bayern entscheidet, ihren Namen zu Ana zu verkürzen, ist es, die die Familie zusammenhält, während die Mutter depressiv-melancholische Züge entwickelt und in der Hoffnung, es könne alles wieder wie früher werden, erstarrt. Schon auf der Flucht mit der wohl letzten Möglichkeit, aus Breslau herauszukommen, übernimmt das Mädchen anstelle der Mutter Verantwortung. Die Problematik des Ankommens bzw. Angenommenseins in der neuen Heimat – für die Andreas Kossert den treffenden Ausdruck „kalte Heimat“ gefunden hat – vernachlässigt der Roman allerdings fast vollständig, auch wenn die Schlesier in der bayrischen Provinz schon wegen ihrer Sprache auffallen, wie überall Notquartiere beziehen müssen und kaum das Allernotwendigste zum Leben haben. Die wenigen, gelegentlich eingestreuten schlesischen Begriffe, die in der Restfamilie Verwendung finden, wirken geradezu unpassend und deplatziert, von echter Traditionspflege weit entfernt. Wenn die höhere Tochter Käthe aus Breslau bei aller Passivität und Verschlossenheit plötzlich als Bayerin auftreten will und darauf besteht, dass die Töchter zum Katholizismus konvertieren, „um in Bayern angenommen zu werden“, erscheint dies doppelt unglaubwürdig, war doch das Festhalten an der vertrauten Konfession nach dem Verlust der Heimat in der Regel ein zentraler Aspekt von Verbundenheit, welcher sehr bewusst und ausdauernd gepflegt wurde.
Beinahe wie nebenher wird die Rückkehr des Vaters aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft erzählt; weder der durchaus schwierige Neubeginn als Familie, die Fronterfahrungen noch seine Tätigkeit als Richter in der NS-Zeit werden mit mehr als zwei, drei Sätzen thematisiert. Die Weigerung des Vaters, einen Prozess im strikt nationalsozialistischen Sinne zu entscheiden, führte seinerzeit zur Versetzung an die Front, jedoch nicht an die gefürchtete Ostfront, sondern nach Italien. In dieser rückblickend erzählten Szene findet die einzige direkte Begegnung mit Gedankengut des „Dritten Reiches“ statt, auffallend in ihrer relativen Harmlosigkeit. Andere, das Leben, Denken und Fühlen der Menschen im Nationalsozialismus prägende Elemente wie die zahlreichen Vorgaben und Anordnungen der Partei, die allgegenwärtige Propaganda und Kontrolle, später die kriegsbedingten Einschränkungen und Gefahren, dann der pädagogisch-pragmatisch durch die Besatzungsmächte bestimmte Nachkriegsalltag werden in wenigen dürren Sätzen abgehandelt oder überhaupt nicht einbezogen. Ebenso sind die Währungsreform und ihre Folgen für die Bevölkerung der Autorin kaum eine Notiz wert. Bemerkenswert nebensächlich bleibt die Rolle des Vaters weiterhin, lediglich als Verdiener ist er von Bedeutung. Seine Verarbeitungsstrategien des erlebten Grauens werden kaum angedeutet, spielen für Frau und Töchter offenbar keine wirkliche Rolle. Nur die weiblichen Mitglieder der Familie erscheinen wichtig und entscheidend.
Schweigen und Tabus bestimmen das Aufwachsen von Ana, wie Anastasia sich jetzt nennt, und ihrer Schwester, doch erst als Erwachsene, die der eigenen Tochter einen Blick in die lange sorgsam verborgene Familienvergangenheit ermöglicht, kann sie dies erkennen und ausdrücken. Mit den Erfahrungen von Verschlossenheit und emotionaler Kälte steht sie stellvertretend für die Generation der Kriegskinder, für eine Generation, die früh Verantwortung übernehmen musste und nicht Kind sein durfte. Manches wurde erahnt, aber vieles blieb unverstehbar, denn es wurde nichts erklärt, nichts gesagt. Fragen wurden nicht beantwortet, bis keine mehr gestellt wurden. Unerfüllte Wünsche und geänderte Lebenspläne wurden als persönliches Schicksal interpretiert, über das man sich nicht austauschte, so dass nichts verarbeitet, sondern im Innern verschlossen wurde – und dort weiterwirkte.
Diese Lebenshypothek als Folge der Erziehung durch das Kriegskind Ana, das sich keine Emotionen erlaubte, nur funktionierte, ihrem Kind nicht sagte, wie wichtig es ihr sei, es nie in den Arm nahm, spürt die Tochter Lilith, die das „Gefühl, nie von einer Mutter geliebt worden zu sein“, hat und die „Furcht, nie wie eine Mutter lieben zu können“, entwickelt. Wenn sie auf einer Breslau-Reise mit ihrer Mutter erkennt, dass sie nicht anders handeln und reden konnte, ist dies einer der konkreten und sachlich angemessenen Bezüge des Romans zur titelgebenden, transgenerationalen Traumabewältigung. „Nichts sollte bei den Frauen ihrer Familie wohl so sein, wie sie es sich gewünscht hätten. Vielleicht wünschten sie es sich eben immer zu viel“, bilanziert Käthes Enkelin. Mit dem Drang nach Perfektion, nach Sicherheit, zugleich innerlich ruhelos, von unbegreiflicher Traurigkeit, wie ein schwarzer Schleier, mit der Unfähigkeit, so fröhlich und unbedarft zu sein wie Gleichaltrige und dem Gefühl, nicht dazuzugehören – nie dazuzugehören – und Auswirkungen bis in die Partnerwahl symbolisiert Lilith die Kriegsenkel, die sich erstmals mit der Vergangenheit und ihren Belastungen auseinanderzusetzen wagen.
Es war nicht ihre eigene Schuld, dass sie so oft an sich selbst zweifelte, dass sie selbst nicht wusste, warum sie in all ihren guten äußeren Umständen nicht wirklich glücklich sein konnte. Warum sie so oft an gläserne Wände gestoßen war. Warum sie ein Leben lang Sammlerin der Augenblicke gewesen war. Weil sie die Bruchstücke der vorherigen Generation nicht zusammenfügen konnte, weil die Auslassungen zu groß waren, weil die unerträglichen Schmerzen von Krieg und Flucht nicht mit dem Ende des Krieges aufgehört hatten. Sie wirkten weiter, in der Kriegsgeneration, in den Kriegskindern und auch in den Kriegsenkeln. Aber es war auch nicht die Schuld der Elterngeneration. Sie hatten zu viel erlebt. Auch und gerade die kleinen Kinder, die all die unerträglichen Erlebnisse erleben mussten. Ohne sie überhaupt zu verstehen, die Zusammenhänge zu sehen, ohne eine Chance, sie zu reflektieren. Sie waren Objekte des Krieges. Objekte der Zeit.
Diese abschließenden Sätze, die so oder ähnlich formuliert bereits vielfach zu lesen gewesen sind, markieren zugleich die stärksten Abschnitte des Buches.
Stefanie Gregg gelingt es – vor allem bei Käthe und Ana – nicht, ihre Protagonistinnen überzeugend darzustellen, sie so zu zeichnen, dass sie den Leserinnen und Lesern vertraut würden. Die schematischen, teilweise klischeehaften Beschreibungen, hölzern wirkende Dialoge mit unpassendem Sprachgebrauch (wie das heute inflationär verwendete „Alles wird gut“, das schwerlich eine Dreizehnjährige des Jahres 1945 ihrer Mutter gesagt haben dürfte), der beinahe völlige Verzicht auf individuelle Besonderheiten und keinerlei herausgehobene Darstellung krisenhafter Vorgänge vermögen keine Empathie zu fördern. Selbst extreme Situationen wie Vergewaltigungen, das massenhafte Sterben während der Flucht oder der angebliche „Widerstand“ des Großvaters werden episodenhaft-harmlos erzählt. Sollte Gregg damit die Distanziertheit und Verlorenheit der Welt ihrer Charaktere ausdrücken wollen, müsste sie andere Wege finden, ihre Leser in die Geschichte hineinzunehmen. Solche Zugänge sind im Text nur in geringen Ansätzen erkennbar.
Die mangelnde Einbindung in historische Ereignisse und Gegebenheiten trägt ebenfalls dazu bei, dass der Roman über Strecken „flach“ und wenig aussagekräftig wirkt. Zudem erscheint die Verknüpfung der Themen Flucht und Vertreibung, Heimatverlust, Neuanfang und Traumatisierung mit einer durch eine Dreiecksbeziehung und Eifersucht bestimmten Gegenwartsentscheidung, wie Lilith sie bewältigen muss, wenig gelungen, vielmehr stark konstruiert. Der Roman wird der Tiefe der Thematik nicht gerecht, bleibt an der Oberfläche.
Die Absicht, Teile der eigenen Familiengeschichte literarisch aufzuarbeiten und einem breiteren Publikum darzubieten, zugleich zeitgeschichtlich bedeutsame Fragen aufzugreifen, wird seit einigen Jahren in vielfacher Ausprägung von Gegenwartsautoren und ‑autorinnen umgesetzt, als Roman wie als Sachbuch. Vor allem in der Belletristik ist dabei ein Trend festzustellen, dem auch Stefanie Gregg folgt: Das Buch soll leicht lesbar sein, mit überschaubarem Personal, die Komponenten Familie, Liebe, Schicksal gefällig gemixt, einzelne Episoden mit mehr oder weniger ausführlich geschildertem historischen Bezug reihend, dazu ein eingängiger Titel und nicht zuletzt eine emotional-historisierende Cover-Gestaltung, die jedoch keine Verbindung zu den Charakteren des Romans herstellt, sondern eine Art zeitgeschichtliches Flair zu vermitteln sucht. Neben „starken“ Frauenfiguren, wie sie auch Gregg mit Anastasia und Lilith wählt, „verschwinden“ die Männer, wenn sie denn überhaupt vorkommen. Dieses Muster entspricht vermeintlich der historischen Realität der Kriegs- und Nachkriegszeit, in der Frauen die Plätze der an der Front und in Gefangenschaft befindlichen Männer übernehmen mussten, markiert aber häufig eine einseitige, feministisch anmutende Weltsicht und bildet die Diversität von Gegenwartsdiskussionen in keiner Weise ab. Berufstätig zu sein, Geld zu verdienen, kreative Lösungen für Probleme zu finden und Verantwortung für Kinder zu übernehmen, sind meist die Kriterien, denen die Protagonistinnen der Romane folgen, während Fragen persönlicher und intellektueller Entwicklung, gleichberechtigter Partnerschaft oder gesellschaftlicher Teilhabe weit weniger Gewicht erhalten. Auch die geradezu erschreckende politische Unbedarftheit vieler Heldinnen fällt auf. Bei einzelnen Gegenbeispielen, wie sie mit der Teilnahme an Studentenprotesten der 1968er oder der Hofgartendemonstration 1983 in Bonn beschrieben werden, bleibt das politisch-gesellschaftliche Engagement auf eine Art Event-Charakter beschränkt und ist weder nachhaltig noch überzeugend. Selbst renommierte Verlage, wie in diesem Fall der Aufbau-Verlag, die lange Zeit für hohe literarische Qualität standen, erliegen inzwischen anscheinend der Versuchung, inhaltlich wie handwerklich austauschbare Massenware auf den Markt zu bringen, die raschen und sicheren Umsatz verspricht. Via Internet werden mit Blogs von Autorinnen und Leserinnen die Bekanntheit und positive Einschätzung vieler Titel unterstützt, wobei nicht selten kritische Stimmen entweder nicht zu finden sind oder die absolute Minderheit darstellen.
Selbstverständlich haben unterschiedliche Formen von Literatur ihre Berechtigung, doch viele Leserinnen und Leser wollen sich nicht nur vordergründig „unterhalten“ lassen – sie möchten auch berührt werden von einer (Familien-)Geschichte, sich einfinden in die Welt, die ihnen auf den Buchseiten eröffnet wird. Im besten Fall lernen sie Neues kennen, werden zur Reflexion angeregt und nehmen Anregungen mit. Stefanie Gregg kann, zumal sie dem gewählten Thema keine erkennbar neuen Aspekte hinzufügt, solche Ansprüche mit Nebelkinder nicht einlösen.
Annegret Schröder