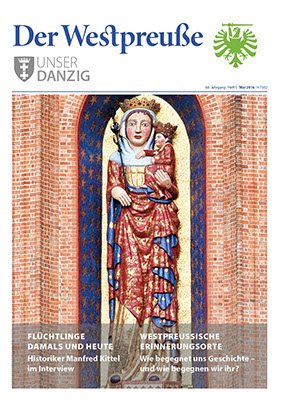Leicht geht derzeit vielen Politikern der Vergleich zwischen ostdeutschen Heimatvertriebenen und heutigen Flüchtlingen über die Lippen. Doch wie tragfähig ist dieser Vergleich? Und welche Konsequenzen ergeben sich, wenn man ihn zu Ende denkt? Hierüber sprach Prof. Dr. Manfred Kittel im Interview mit Tilman Asmus Fischer.
Herr Professor Kittel, welche Unterschiede sehen Sie zwischen den heutigen Herausforderungen der Flüchtlingskrise und der Integration der deutschen Heimatvertriebenen nach 1945?
Die Unterschiede liegen in allererster Linie darin, dass damals nach 1945 Deutsche nach Deutschland gekommen sind und wir es bei den Migrationsströmen von heute mit Menschen aus ganz anderen kulturellen und religiösen Zusammenhängen zu tun haben – sogar aus anderen Kontinenten. Dieser Unterschied ist vor allem im Hinblick auf die Integrationspotenziale, Chancen und Risiken, wichtig.
Welche Bedeutung haben für die Integration juristische Fragen des Bleiberechts oder der deutschen Staatsbürgerschaft?
Der kulturelle Aspekt stellt tatsächlich nur einen Gesichtspunkt dar. Der staatsrechtliche ist aber ebenfalls wichtig: Die gute Hälfte der Flüchtlinge und Vertriebenen, die am Ende des Zweiten Weltkriegs und danach in den Rest Deutschlands kamen, waren von vornherein bereits deutsche Staatsbürger – genauso wie diejenigen, die sie aufnehmen mussten. Also waren Fragen wie Staatsbürgerschaft oder Bleiberecht in allen Besatzungszonen erstmal nicht das Problem. Nur ein kleinerer Teil der Vertriebenen, etwa aus Ungarn oder Jugoslawien, besaß die deutsche Staatsbürgerschaft zunächst nicht. Und trotzdem war die Integration der deutschen Flüchtlinge und Vertriebenen nach 1945 vor allem im Westen Deutschlands am Ende zwar ein Erfolg, jedoch auch ein unglaublicher Kraftakt. Das wird in politischen Sonntagsreden heute etwas sehr pastellfarben gemalt. Die konflikthaften Dimensionen dieses Integrationsprozesses, etwa bei der Zwangseinquartierung oder im Alltag, sind aber nicht zu übersehen.
Was bedeutet das für den Vergleich mit der heutigen Situation?
Wenn schon die Integration von 12 Millionen Menschen aus einem ähnlichen kulturellen und religiösen Kontext so schwierig und mit riesigen Konflikten in den ersten Jahren verbunden war, kann man sich ausmalen, was es bedeuten würde, in dieser Dimension heutige Flüchtlinge und Vertriebene in unserem Land integrieren zu müssen.
Müssten wir demnach stärker als bisher danach fragen, was wir aus den damals gemachten Fehlern lernen können?
Genau das müsste man. Dann würde man zum Beispiel beim Faktor Religion etwas vorsichtiger werden: Nach 1945 hat bereits der Zusammenprall von Katholiken und Protestanten in etlichen bis dahin eher monokonfessionellen deutschen Aufnahmegebieten zu enormen Reibungen geführt. Auch in der Nachkriegszeit war das konfessionelle Denken als politischer Konfliktfaktor eben noch sehr spürbar, und es gab unglaubliche Probleme wegen konfessioneller Befindlichkeiten zwischen zuziehenden Anderskonfessionellen und traditionellen Mehrheitsmilieus. Wenn man bedenkt, dass es sich heute meist nicht nur um eine andere Konfession handelt, sondern um eine – wenn auch abrahamitisch – in vielem sehr andere Religion, kann man sich an zehn Fingern abzählen, was dies bedeutet. Wir sehen ja bereits in den hiesigen Flüchtlingslagern, dass es zwischen Syrern der muslimischen Mehrheit und der christlichen Minderheit Probleme gibt, die außerordentlich beunruhigend sind.
Wo würden Sie trotz aller Unterschiede auch Gemeinsamkeiten zwischen den deutschen Ostvertriebenen und heutigen Flüchtlingen sehen? Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach in ihrer Rede beim BdV-Jahresempfang am 12. April in Berlin von einer verbindenden „Erfahrung, alles zurückzulassen und einen Weg ins Ungewisse zu gehen“.
An dem Punkt gibt es tatsächlich ganz erhebliche Gemeinsamkeiten: Aber gerade weil bereits bei Menschen, die aus ähnlichen Kontexten kamen, die Integration so schwierig war, sieht man auch, dass die Erfahrungen von Fremdheit nicht nur damit zu tun haben, dass man in eine kulturell völlig andere Umwelt kommt. Vielmehr reicht es unter Umständen schon aus, wenn es andere Dialekte, Sitten und Gebräuche sind, die als fremd empfunden werden. Ich habe oft bei Vorträgen im landsmannschaftlichen Bereich erlebt, dass sich viele aufgrund der gegenwärtigen Konflikte daran erinnert fühlen, wie es ihnen selbst 1945 und in den Jahren danach ergangen ist: Wie schwierig es war, in der Fremde anzukommen.
Was lehrt uns die Geschichte jenseits der individuellen Lage der Flüchtlinge über die Aufnahmebereitschaft der ansässigen Bevölkerung – damals wie heute?
Bei aller Bereitschaft – sowohl in den Westzonen wie in der SBZ –, zumindest ein Stück weit zu teilen und – vielleicht damals auch in Anbetracht der gemeinsamen Verantwortung für den Nationalsozialismus und seine Folgen – einen gewissen materiellen Lastenausgleich vorzunehmen, waren dieser Bereitschaft gesellschaftlich immer auch Grenzen gesetzt. Es gab in beiden Fällen etwa den einheimischen Handwerksmeister, der die Ansiedlung vertriebener Konkurrenten am liebsten verhindern wollte. Nun bin ich Historiker und kein Anthropologe, aber die Ähnlichkeiten in der Reaktion auf Flüchtlinge und Vertriebene, ob im demokratischen oder im diktatorialen Teil Deutschlands, scheinen doch sehr dafür zu sprechen, dass wir es hier mit anthropologischen Grundkonstanten zu tun haben, die auch von der heutigen Politik nicht per Knopfdruck in einem gleichsam humanitär-voluntaristischen Akt außer Kraft gesetzt werden können.
Wissen Sie, ich bin im evangelisch-lutherischen Franken noch ganz selbstverständlich christlich sozialisiert worden und im Zuge dessen eigentlich immer davon ausgegangen, dass der Mensch seit Adam und Eva ein Mängelwesen ist und wir auf Erden wohl niemals das Paradies erreichen werden. Man muss einfach sehen, dass eine nur aus guten Menschen bestehende Aufnahmegesellschaft nicht einmal mit Rousseaus Erziehungsdiktatur generierbar wäre. Deshalb muss man „höllisch“ aufpassen, dass keine Umstände eintreten, unter denen die schlechteren das Übergewicht bekommen. Weil es leider Gottes viele, nicht zuletzt auch ökonomisch-soziale, Gründe dafür gibt, dass die „schlechteren“ im 21. Jahrhundert vorläufig erst einmal noch nicht ganz aussterben werden, sondern das bedroht gefühlte Eigene gegen das Fremde verteidigen, gibt es faktisch selbstverständlich immer Grenzen hinsichtlich der Kapazität von Gesellschaften für Flüchtlingsaufnahme.
Für die deutschen Vertriebenen nach 1945 war lange Zeit auch die Rückkehr in die angestammte Heimat ein zentrales Anliegen. Welche Stellung nimmt Ihrer Einschätzung nach das Thema „Rückkehr“ im aktuellen Diskurs ein?
Im vergleichenden Blick halte ich es schon für überraschend, wie wenig insgesamt über diese Rückkehrperspektive gesprochen wird. Gerade durch die politischen Entwicklungen in den letzten Wochen haben wir doch gesehen, dass man vielleicht nicht alle Hoffnung fahren lassen muss, was die Dauer des Krieges in Syrien, die schwierige Lage im Irak und die IS-Herrschaft anbelangt. Insofern ist es umso merkwürdiger, dass von einer dauerhaften Bleibeperspektive für fast alle ausgegangen wird, die nach der Genfer Flüchtlingskonvention so überhaupt nicht gegeben ist. Bisweilen wird auf geltendes Aufenthaltsrecht und dessen Zusammenwirken mit Flüchtlings- und Staatsangehörigkeitsrecht verwiesen. Aber müssen die entsprechenden Regelungen nicht schleunigst geändert werden, wenn sie sich in Zeiten von Massenzuwanderung als nicht mehr zeitgemäß erweisen?
Welcher Weg sollte stattdessen rationaler Weise eingeschlagen werden?
Nach den geltenden Regularien der UN-Flüchtlingshilfsorganisation ist das ganz klar: Die Schutzverpflichtung des aufnehmenden Staates endet, wenn die Fluchtursachen nicht mehr bestehen. Dann soll, kann und muss es auch darum gehen, die erheblich zerstörten Herkunftsländer wieder aufzubauen. Und es ist ja an sich normal und natürlich, dass man noch viele Jahre nach einem erzwungenen Heimatverlust, der sich in Form einer ethnischen oder politischen Säuberung vollzogen hat, den stark ausgeprägten Wunsch hat, in die Heimat zurückzukehren: Noch zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gründeten die deutschen Landsmannschaften Arbeitsgemeinschaften für Rückkehrplanung und gaben die Vertriebenen in Umfragen zu erkennen, dass sie, wenn die politischen Verhältnisse dies hergegeben hätten, selbstverständlich gerne wieder zurückgehen würden. Ich kann gar nicht verstehen, warum das heute anders sein sollte. Es sei denn, es stimmte, worauf etwa der österreichische Außenminister mehrfach hingewiesen hat, dass bei den Migrationsmotiven doch auch ökonomische eine wesentliche Rolle spielten. Für Wirtschaftsmigration aber ist die Genfer Flüchtlingskonvention nicht gemacht.
Prof. Dr. Manfred Kittel war von 2009 bis 2014 Direktor der Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung, heute forscht er in Berlin zu Fragen der Flüchtlings- und Vertriebenenintegration.