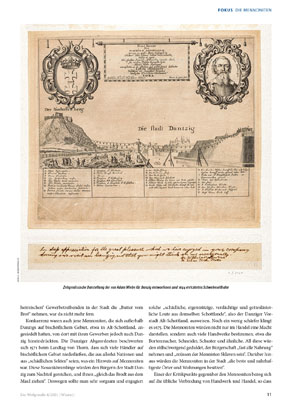Von Astrid von Schlachta
1635 schrieb der holländische Legationssekretär Charles Ogier auf einer Reise durch Preußen königlichen Anteils: „Die Holländer sind’s, die jene Landschaften trockenlegten und die nutzlosen Sümpfe mittels gegrabener langer Kanäle und Wasserläufe in Ackerland, Wiesen und Gärten voller Früchte verwandelten.“ Unter diesen Holländern waren viele Täufer, die im 16. Jahrhundert aus den verschiedensten Gründen nach Danzig, in den Marienburger Werder sowie nach Elbing und Thorn eingewandert waren. Obwohl, oder gerade weil die politischen Strukturen aufgrund der unterschiedlichen Herrschaftsrechte sehr verschachtelt und komplex waren, entwickelten sich natürliche Schutzräume für die Täufer. Denn die Städte versuchten nicht selten, die Täufer zu instrumentalisieren, um ihre Eigenständigkeit gegenüber dem polnischen König zu unterstreichen und ihre Emanzipation zu fördern. Der Zuzug der Täufer war, wie generell in der Frühen Neuzeit, durch Privilegien geregelt: Tolerierung gegen Auflagen. Besonders wichtig und fast überall begleitend zu den Privilegien festgelegt wurde das Verbot für die Täufer, Konvertiten zu machen. Doch diese Tolerierung durch Privilegien war stets eine Tolerierung auf Zeit und auf Widerruf. Und meist war sie verbunden mit hohen Geldzahlungen, etwa der doppelten Accise, oder Schutz- und Schirmgeld.
Danzig spielt für die täuferische Geschichte als eine der bedeutendsten Handelsstädte der Ostseeregion eine besondere Rolle. Sie war vergleichbar mit jener der niederländischen Städte oder Krefelds, wo sich die Täufer in das aufstrebende Wirtschafts- und Handelssystem der Stadt einpassten und erfolgreiche Handwerke und Handelsunternehmen etablierten. Auch in den Vorstädten, auf bischöflichem Gebiet, etwa in Alt-Schottland, siedelten sich Täufer an. Nach Elbing zogen im 16. Jahrhundert ebenfalls viele Täufer, wobei sie hier auf noch günstigere Bedingungen trafen als in Danzig.
Integration in die Gesellschaft – Wirtschaft und Handel
Wie bereits das Zitat von Charles Ogier zum Ausdruck bringt: Den Einwanderern kam eine bedeutende Rolle in der Kultivierung, Entwässerung und Eindeichung des Weichseldeltas zu. In Danzig selbst stiegen die Mennoniten rasch im Gewerbe und im Handel auf. 1661 waren drei Viertel der Mennoniten Kaufleute, Spediteure und Faktoren, die im Auftrag holländischer Firmen den Handel lenkten. Das restliche Viertel war tätig in der Herstellung und im Vertrieb von Posamenteriewaren (d. h. Borten, Litzen und Fransen) und als Spirituosenbrenner. Zu den bekannten Produkten des letztgenannten Zweiges gehörten die Liköre und Branntweine der Firma Lachs, die seit 1598 im Haus Zum Lachs von Mennoniten hergestellt wurden. Besonders erfolgreich war das Danziger Goldwasser. Die Firma Stobbe gelangte mit ihrem Schnaps Machandel ebenfalls zu einiger Berühmtheit. Doch Mennoniten waren auch im Ingenieur- und Bauwesen tätig. So zeichnete einer von ihnen, Adam Wiebe, für die Konstruktion der ersten Schwebeseilbahn verantwortlich. Wiebe (1584–1653) baute 1644 eine Materialseilbahn, um die Vorstädtische Bastion in Danzig zu versorgen. Und der Mennonit Peter Willer (1635–ca. 1700) wirkte als Baumeister, Wasseringenieur, Kartograph und Kupferstecher.
Die Mennoniten in Danzig wurden zwar wirtschaftlich erfolgreich, blieben rechtlich jedoch immer in einer unsicheren Lage. Sie verfügten in der Stadt bis zum Jahr 1800 nicht über das Bürgerrecht, was Probleme unter anderem beim Grundbesitz und beim Vererben nach sich zog. Anders gestaltete sich die Situation in Elbing. Dort hatten einzelne Mennoniten schon im 16. Jahrhundert das Bürgerrecht, auch wenn es immer wieder Debatten darüber gab. In Danzig dagegen waren Mennoniten nur „Geduldete“ und durften unter anderem auch nicht Mitglied der Zünfte sein. Somit ließen sich Streitigkeiten über Rechte und Pflichten gut instrumentalisieren, denn es ging um Verdienst und Gewinn sowie um „Marktanteile“ – und das Argument „die Mennoniten stören“ konnte jederzeit aktiviert und reaktiviert werden.
Klagen einzelner Berufsgruppen über die mennonitische Konkurrenz gab es regelmäßig, beispielsweise von den Destillierern Danzigs. 1664 beschwerten sie sich in einer Eingabe an den Stadtrat, dass die Mennoniten in „allerlei Wollust und Üppigkeit leben“ würden, was „wir Distillirer insgesambt nicht einem Mennoniten gleich thun können“. Ihr Wachstum würde vor allem, so die Destiller, daher kommen, dass sie als große Gruppe fest zueinander hielten und von niemandem anderen, als nur von ihren Glaubensgeschwistern kaufen und an sie verkaufen würden. Auch ihre Grundzutaten würden die Mennoniten bei Schiffsleuten beziehen, von denen der größte Teil Mennoniten sei, die ihnen auch Zucker, Anis und „dergleichen aus Holland umb den besten preiß“ verkauften. Der Vorwurf lautete also nicht nur, die Mennoniten würden sich abseits der zünftischen Normen einigen Wohlstand erarbeiten, sondern bezog sich auch auf die Vormacht konfessioneller Netzwerke, die bis in die mennonitische Produktion und in den mennonitischen Handel in Danzig reichen würden: eine nahezu geschlossene Gesellschaft mit monopolartigen Ausprägungen, was Einkauf und Verkauf betraf. Die Stigmatisierung, die Mennoniten würden als „fremde Sektierer“ den „einheimischen“ Gewerbetreibenden in der Stadt die „Butter vom Brot“ nehmen, war da nicht mehr fern.
Konkurrenz waren auch jene Mennoniten, die sich außerhalb Danzigs auf bischöflichem Gebiet, etwa in Alt-Schottland, angesiedelt hatten, von dort mit ihren Gewerben jedoch nach Danzig hineindrückten. Die Danziger Abgeordneten beschwerten sich 1571 beim Landtag von Thorn, dass sich viele Händler auf bischöflichem Gebiet niederließen, die aus allerlei Nationen und aus „schädlichen Sekten“ seien, was ein Hinweis auf Mennoniten war. Diese Neuankömmlinge würden den Bürgern der Stadt Danzig zum Nachteil gereichen, und ihnen „gleich das Brodt aus dem Maul ziehen“. Deswegen sollte man sehr sorgsam und engagiert solche „schädliche, eigennützige, verdächtige und gotteslästerliche Leute aus demselben Schottlande“, also der Danziger Vorstadt Alt-Schottland, ausweisen. Noch ein wenig schärfer klingt es 1675. Die Mennoniten würden nicht nur im Handel eine Macht darstellen, sondern auch viele Handwerke bestimmen, etwa die Bortenmacher, Schneider, Schuster und ähnliche. All diese würden stillschweigend geduldet, der Bürgerschaft „fast alle Nahrung“ nehmen und „müssen der Mennisten Sklaven sein“. Darüber hinaus würden die Mennoniten in der Stadt „die beste und nahrhaftigeste Örter und Wohnungen besitzen“.
Einer der Kritikpunkte gegenüber den Mennoniten bezog sich auf die übliche Verbindung von Handwerk und Handel, so dass die Forderung vorgebracht wurde, Herstellung und Vertrieb zu trennen, um die machtvolle Stellung der Mennoniten zu brechen. 1648 entschied der Stadtrat daher, im Sinne dieser Forderungen vorzugehen: „Weil Fremde mit Fremden zu handeln nicht befugt und zwischen Bortenmacher und Bortenhändlern ein notwendiger Unterschied zu halten ist.“ Mennoniten beschwerten sich daraufhin und schrieben eine Eingabe an den Rat der Stadt. Sie stellten fest, dass die Bortenwirker bereits seit „Uhralten Zeiten“ die Freiheit hätten, mit Passementen (Kordeln und Fransen) zu handeln. Zugleich wiesen sie darauf hin, dass diese ungerechtfertigten Anschuldigungen schon seit längerer Zeit gegen sie verwendet würden. Das gesellschaftliche Klima besserte sich jedoch nicht, sondern der Wind wehte den Mennoniten nun noch etwas rauer um die Nase. In der Folge verließen einige Täufer Danzig und zogen über die Weichsel in die Nehrung sowie in den zur polnischen Krone gehörenden Großen Werder.
Wirtschaftliche Gründe waren auch ausschlaggebend für die Gründung einer Mennonitengemeinde in Königsberg, die 1722 entstand und direkte Verbindungen nach Danzig hatte. Diese neue Gemeinde war zwar geduldet und mit Privilegien ausgestattet, aber ebenfalls nicht dauerhaft gesichert. Seit 1716 hatte es bereits private Versammlungen gegeben – „in aller Stille“ und „ohne rumor“, wie es im Privileg heißt. In diesem Jahr erteilte der Magistrat der Stadt Kneiphof, einer der drei 1724 vereinigten Königsberger Städte, dem Mennoniten Johann Peter Sprunk die Erlaubnis, sich in der inneren Vorstadt niederzulassen, um eine Branntweindestillation zu eröffnen. Der Erlaubnis ging auch hier der Wunsch nach einer Erweiterung der Gewerbe in der Stadt voraus, denn in Königsberg gab es niemanden, der den Branntwein „nach Danziger Art“ destillieren konnte. Das Schlupfloch für einen Mennoniten war also, ein Handwerk zu betreiben, das ein typisch mennonitisches geworden war: die Branntweinbrennerei.
Schwankungen in den Lebensmodalitäten täuferisch-mennonitischer Existenz, die von den jeweiligen gesellschaftlichen Entwicklungen abhingen und entweder zu wohlwollender Aufnahme oder zu Stigmatisierung führen konnten, lassen sich auch in Elbing nachverfolgen. Dort herrschte eigentlich zunächst ein sehr offenes Klima, das Täufern Chancen auf Niederlassung und wirtschaftliche Entfaltung bot. Dies zeigte sich unter anderem auch daran, dass ihnen das Bürgerrecht gewährt wurde und ihnen erlaubt war, ohne Eidschwur Bürger zu werden. Als sich die wirtschaftliche Lage in Elbing jedoch verschlechterte, wurden die Mennoniten zunehmend als unliebsame Konkurrenz wahrgenommen. Der Rat der Stadt änderte in dieser Zeit seine Politik und installierte kleine Hürden – wie die Zahlung von Schutzgeld oder neue Praktiken beim Eidschwur. Ab 1682 mussten die Mennoniten bei der Eidesleistung mit Ja oder Nein die Hand auf die Brust legen, was sie als Verletzung ihrer Gewissensfreiheit ansahen.
Ähnlich ambivalent gestalteten sich Äußerungen zur Tolerierung der Täufer, die sich in den Schriften der preußischen Kurfürsten und Könige finden, wie etwa im Fall König Friedrich Wilhelms I. gezeigt werden kann. Waren die Täufer für die Wirtschaft wichtig, forcierte er ihre Einwanderung. Ergaben sich Probleme oder erbrachten die Täufer nicht den erhofften Nutzen, so zog der König andere Einwanderer vor. Im Zusammenhang mit der Ansiedlung von Mennoniten in Preußisch-Litauen ist das Zitat überliefert: „sehr wahr ist die menonisten schweitzer mein Ruin“. Und weiter heißt es: „Ich will von das geschmeiße nit – Ihre kinder werden nit soldahten – Ist guht solche leutte vor Particulier, aber nit vor groß herren.“ Über die Mennoniten in Krefeld ist dagegen folgende Aussage des preußischen Königs überliefert: „Die Mennonisten wollen zwar nicht in den Krieg gehen, ich muss aber auch Leute haben, die mir Geld schaffen.“
Mennoniten zwischen Absonderung und Integration – kulturelles und geistliches Leben
Das täuferische Leben war nicht nur von seinen äußerlichen Rahmenbedingungen immer wieder Veränderungen unterworfen, sondern auch das kulturelle und geistliche Leben der Gemeinden und ihrer Glieder bewegte sich stets auf einer Skala, die von Traditionalisierung bis Erneuerung und Aufbruch, von der alten Praxis der Absonderung, die als wesentlich für das Glaubensleben gesehen wurde, bis hin zu dem Wunsch ging, als erfolgreiche Kaufleute auch politisch mitsprechen zu wollen – und sich somit aus der Absonderung herauszubegeben. Für die Gemeinden selbst ergaben sich aus diesen Entwicklungen und Veränderungen immer wieder spannungsreiche Diskussionen und Konflikte.
Einen interessanten Einblick in die Debatten, die sich um die Bewahrung des Altbewährten und den Wunsch nach Erneuerung drehten, gibt ein sich im frühen 18. Jahrhundert abspielender Streit um das Tragen von Perücken. In der Zeit entsprach es dem Schönheitsideal, dass auch ein Mann sich eine Perücke – als Statussymbol – auf den Kopf setzte. Die Mennoniten, die man zunächst vielleicht gar nicht damit in Verbindung bringt, dem neuesten Modetrend zu folgen, blieben von dieser Entwicklung nicht unberührt. Angestoßen wurde der sich um das Perückentragen drehende Streit durch den Sohn bzw. den Schwiegersohn des Danziger Bankiers Jan van Hoek. Sie waren nach einem Aufenthalt in Amsterdam in ihre Gemeinden Danzig und Markushof im Kleinen Marienburger Werder zurückgekehrt und hatten die neue Mode des Perücken-Tragens mitgebracht, was in der traditionell ausgerichteten mennonitischen Gesellschaft Danzigs für viel Zwistigkeiten sorgte. So verweigerte der Älteste der Mennonitengemeinde den Zurückgekehrten das Abendmahl, denn seiner Meinung nach bedeutete das Tragen von Perücken, gegen die „alte gewohnte“ zu handeln und eine „neuerung“ einzuführen.
Der Streit zog seine Kreise bis in den Stadtrat hinein, der sich einschaltete, da die jungen Männer um Unterstützung gegen die als unrechtmäßig empfundene Kirchenzucht gebeten hatten. Aus den Reihen des Stadtrats kamen denn auch Aufforderungen an die Ältesten der Gemeinde, alle Maßnahmen gegen die jungen Männer zurückzunehmen. Die Ältesten hielten dagegen und wiesen darauf hin, dass man gerade als Mennonit sich ruhig und unauffällig verhalten sollte – und dem stünde das Perücke-Tragen entgegen. Es gäbe, so hieß es, immer genug Leute, die „wünschen, dass wir aus dem Land wären“. Und die Ältesten holten noch weiter aus, indem sie bemerkten, selbst die Fürsten und großen Herren im Land würden keine Perücken aufsetzen, obwohl sie alt seien und „fast keine haar auf dem haubte“ hätten.
Auch die Kunst hatte es unter den Mennoniten des 18. Jahrhunderts schwer, sich in den preußisch-polnischen Gebieten an der Ostsee durchzusetzen, was unter anderem der Maler Enoch Seemann zu spüren bekam. Seemann wurde 1697 vom Ältesten der Danziger Gemeinde, Georg Hansen, gebannt, weil er als Porträtmaler gegen das 2. Gebot gehandelt habe: Du sollst Dir kein Bild machen. Ganz generell ging es in der Auseinandersetzung jedoch schnell um Malerei an sich. Denn die Ältesten brachten auch die Frage in die Diskussion ein, ob Landschaft – eigentlich ja unverdächtig – nicht ebenfalls als „Geschöpf Gottes“ anzusehen sei, und somit gleichermaßen als „nicht malbar“ eingestuft werden sollte. Seemann verteidigte seine Kunst der Porträt- und Landschaftsmalerei vehement und versuchte, seine Kontrahenten mit der Werbung an ihren eigenen Läden zu schlagen. Er argumentierte nämlich, dass die Läden der mennonitischen Krämer auch mit Ladenschildern versehen seien, auf denen Bilder seien – und dies verstoße dann offenkundig doch nicht gegen das Bildnisverbot.
Seemann fand seine Widersacher in der flämisch ausgerichteten Danziger Mennonitengemeinde, die als sehr konservativ galt. Und dies brachte eben eine wesentlich konsequentere und strengere Gemeindezucht mit sich, bei der der Bann keine Seltenheit war. Der bereits zitierte Gesandtschaftssekretär Charles Ogier beschrieb die flamisch geprägten Mennoniten 1636 als „stille, bescheidene, sehr geschickte Handwerker“. Sie trügen eine „gediegene, unauffällige, meist dunkle Tracht“; ihre Frauen hätten an ihren Kleidern, die aus feinen, gewählten Tuchsorten (Camelot und Turquie) bestanden, „keinerlei Borten oder Zierrat“. Bestimmte Kleiderfarben, Schuhformen, Kragenarten, Haar- und Barttrachten waren nicht geduldet; auch nicht der Besitz von Spiegeln oder Bildern und eben besonders keiner Porträts.
Simon Rues, ein lutherischer Geistlicher, beschrieb noch 1743 in seinem Werk Aufrichtige Nachrichten von dem gegenwärtigen Zustande der Mennoniten oder Taufgesinnten die Einfachheit und Schlichtheit mennonitischen Lebens. So würden es die Danziger Mennoniten als Sünde ansehen und auch den Bann aussprechen, wenn eine Familie Gemälde an den Wänden hängen hätte, Möbel mit Porzellan oder kostbaren Gläsern schmückte, – „ja, wenn man gar auf die Thorheit geriethe, wie sie sagen, um sich selbsten abmahlen zu lassen; wenn man […] vor die Obrigkeit gienge, um vor derselben Klage zu führen.“
Nach diesem Streifzug durch das wirtschaftliche und kulturelle Leben der Mennoniten im Land an der unteren Weichsel bleibt festzuhalten: Die täuferisch-mennonitische Landschaft war in den preußisch-polnischen Regionen an der Ostsee äußerst vielfältig, rechtlich und territorial sehr unterschiedlichen Rahmenbedingungen unterworfen und von häufigen kleinräumigen Migrationen, Ansiedlungswünschen und ‑ablehnungen sowie von Vertreibungen geprägt. Die preußisch-polnischen Gebiete an der Ostsee stehen somit exemplarisch für eine Konstante täuferischer Existenz in der Frühen Neuzeit.
Die Zuwanderung und Duldung von Mennoniten war stets eine hochpolitische Frage; ihre Existenz war prekär und nie auf Dauer gesichert. Die Klagen gegen die Übermacht der mennonitischen Gewerbetreibenden zogen sich in der gesamten Frühen Neuzeit durch die politische Kommunikation der preußisch-polnischen Gebiete an der Ostsee. Und es wird deutlich, dass es jeweils nicht nur eine Momentaufnahme war, die in den Mennoniten eine weitgehend geschlossene Gesellschaft und somit eine Macht am Markt sah. Die konfessionelle Kohärenz wirkte sich bis in Handwerk und Handel aus, wenngleich Tendenzen der soziokulturellen Entwicklung auch bis ins Innere der Gemeinden vordrangen, was die Vielfalt mennonitischen Lebens deutlich macht.
Für die politische Obrigkeit ergab sich eine dauerhafte Spannung zwischen dem Wunsch, die Täufer und Mennoniten zu dulden, weil man sich einen wirtschaftlich-monetären Vorteil erhoffte, und der Reaktion auf die wirtschaftlich motivierten Klagen aus den Reihen der anderen Gewerbetreibenden, dass die mennonitische Übermacht zu groß würde und die „Einheimischen“ zu kurz kämen. Die Mennoniten waren also wirtschaftlich zwar erwünscht und aufgrund ihrer innovativen Handwerke gesuchte Untertanen, doch gleichzeitig in einer insofern ungesicherten Position, als sich für sie der Wind mit der wirtschaftlichen Großwetterlage immer ändern konnte.